Es ist Mitte Februar. Die Tage werden spürbar länger. Die Sonne scheint bereits etwas kräftiger durch das noch laublose Astwerk der Waldbäume und verzaubert den Wald in ein geheimnisvolles Spiel mit dem Licht. Noch etwas zaghaft ertönen die ersten Vogelstimmen. Vorab ist es die Misteldrossel mit ihrem etwas melancholischen und leicht flüchtig hingeworfenen, dem Amselgesang ähnlichen Lied. Sie erfreut die Waldbesuchenden aus den oberen Regionen der noch kahlen Baumkronen.
Die Singdrossel – sie ist knapp so gross wie ein Star – nimmt kein Blatt vor den Schnabel und trägt ihr Lied klar und deutlich, einzelne Motive oft wiederholend, in den Vorfrühlingswald. Auch Sie bevorzugt für Ihren Gesangsvortrag die oberen Regionen der Nadelbäume. Längst vor diesen beiden Drosselartigen, nämlich im Dezember war der Waldkauz bereits auf Brautschau und hat mit seinem «huuh» mit dem anschliessenden tremolierenden «u-u-u-u» sein Brutrevier gegenüber Artgenossen «ausgerufen». Wer im Dezember und Januar nach dem Eindunkeln den Winterwald im Schnee nicht scheut, hat mit etwas Geduld grosse Chancen, den «Nachtheuel» zu hören.

Erste Singvögel kehren ins Sommerquartier zurück
So Anfang März kommen dann die ersten kleinen Singvögel aus ihrem Überwinterungsgebiet in Südwesteuropa in ihr Sommerquartier zurück. Die Mönchsgrasmücke verrät sich mit ihrer angenehm und fröhlich klingenden Strophe. Dazu gesellt sich der Zilp-Zalp, ein kleiner unscheinbar gefärbter Zweigsänger. Seine zweisilbige Singstrophe hat ihm seinen Namen gegeben. Mönchsgrasmücke und Zilpzalp sind Bewohner von Hecken und suchen sich deshalb die lichten Partien im Wald aus für ihr bevorstehendes Brutgeschäft.
Auch der Schwarzspecht kündet mit seinem von weitem hörbaren «Gliüü» die wärmer werdenden Tage an. Die Ringeltauben gurren wieder hoch oben in den Bäumen und vollführen mit klatschenden Flügelbewegungen ihren Revierflug. Die Hohltauben haben ihr Revier bereits bezogen. Von ihnen hört man nur selten ein leises fast etwas zögerliches Gurren. Sie sind sehr selten, denn zum Brüten sind sie auf Höhlen in Bäumen, vorzugsweise auf verlassene Schwarzspechthöhlen angewiesen. Diese gibt es in unserer Gegend ausschliesslich in hochschaftigen Buchen.
Von Tag zu Tag kommt jetzt mehr Leben in den Wald. Alle diese Flugkünstler sind mit einem Fernglas gut zu beobachten, denn die Bäume haben noch keine Blätter ausgetrieben, die uns die Sicht verdecken. Weitere Wald bewohnende Vögel kommen laufend in ihr Sommerquartier zurück und teilen den Lebensraum mit denjenigen Arten, die den Winter über hier bleiben oder sich nur teilweise in wärmere Gegenden zurückgezogen haben.
Einer der spätesten Ankömmlinge ist der Trauerschnäpper. Er erscheint so gegen Ende April Anfangs Mai. Sein etwas abgehackter trotzdem aber wohlklingender Gesang verrät ihn. Finden kann man ihn in eher warmen , trockenen , lichten und parkähnlichen Waldpartien, wo er sich auf der mittleren Etage der Laubbäume am wohlsten fühlt.
Jede Nische im Wald gefüllt mit Vogelleben

Das neue lichte Laubgrün schenkt dem Wald eine spezielle Atmosphäre. Viele unterschiedliche Waldpartien wechseln sich ab. Lichte Stellen wechseln ab mit dunkleren Partien, Junges Holz mit altem Holz, feuchte Tobel mit trockenen Kuppen, nährstoffreiche mit mageren Standorten, dazwischen Übergangsbereiche. Jede dieser Zonen weist eine speziell an sie angepasste Flora und Fauna auf. Die gefiederten Bewohner profitieren von diesem Reichtum und finden darin den ihnen zusagenden Lebensraum. Jetzt, Anfangs Mai, ist sozusagen jede Nische im Wald gefüllt mit Vogelleben. Die Männchen stimmen frühmorgens ein in das grosse Vogelkonzert. Alle singen sie durcheinander. Trotzdem tönt es nicht falsch, nichts von Disharmonie, ein wunderschönes Erlebnis. Wer sich die Mühe nimmt, die Stimmen der einzelnen Vogelarten kennen zu lernen, dem öffnet sich sozusagen eine neue Dimension, eine staunenswerte neue Welt, und erst noch vor der eigenen Haustüre.
Permanente Überwachung des Brutvogelbestandes im Kanton Zürich

Das Brutgeschäft ist Anfangs Mai zum Teil bereits im Gange, zum Teil beginnen die Spätankömmlinge erst mit dem Nestbau. Welche Vogelart brütet jetzt aber wo im Wald und wie entwickelt sich ihr Bestand? Eine permanente Überwachung des Brutvogelbestandes im Kanton Zürich gibt Aufschluss darüber. Verschiedene Landschaftsräume über den ganzen Kanton verteilt, wie Wald, Kulturland und Siedlung unterstehen einem jährlichen Monitoring. Seltene Vogelarten, die spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum stellen, sowie solche, die sehr grosse Reviere beanspruchen, werden separat erfasst.
Zusätzlich wurden in den Jahren 1986–1988 und 2006–2008 die brütenden Vogelarten im ganzen Kanton flächendeckend durch rund 250 freiwillige Ornithologen und Ornithologinnen erfasst. Somit stehen heute aussagekräftige Vergleichszahlen über die Entwicklung des Brutvogelbestandes bis auf Gemeindeebene zur Verfügung. Der Projektträger dieser Bestandesaufnahmen ist der Verband der Natur- und Vogelschutzvereine ZVS/BirdLife Zürich. Unterstützt wird das Projekt vom Amt für Landschaft und Natur bei der kantonalen Baudirektion.
Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung von 25 im Wald vorkommenden Vogelarten in systematischer Reihenfolge, bezogen auf die Waldfläche in der Stadtgemeinde Winterthur.
Der Leser und die Leserin mögen sich nun fragen, wie denn die Vögel gezählt werden. Kann man Vögel überhaupt zählen? Ja, man kann das. Die wissenschaftliche Forschung zeigt nämlich auf, dass die Mehrzahl der Singvögel während der Brutzeit einen Landschaftsraum mit einer bestimmten Grösse beanspruchen, um sich damit die erforderliche Menge Futter für die hungrigen Jungen zu sichern.
Unterschiedliche Waldtypen, unterschiedliche Vogelarten
Dieses sogenannte Revier verteidigt das Männchen und das Weibchen gegenüber artgleichen Eindringlingen. Mitunter sind dabei heftige Kämpfe um die Reviergrenze zu beobachten. Alle anderen Arten werden dabei toleriert, denn bei der Futterbeschaffung teilen sie sich verschiedene Nischen, indem jede Art spezielle Partien an Bäumen und Sträuchern nutzt. Zudem schliessen sich einzelne Arten zum vornherein aus, weil sie unterschiedliche Waldtypen bevorzugen und sich dadurch nicht in die Quere kommen. Ab und zu naschen beim Nachbarn ist trotzdem erlaubt, abgesehen davon, dass die Territoriumsgrenzen grosszügig ausgelegt werden. Nach der Brutzeit lösen sich die Reviere wieder auf.
Die Männchen signalisieren also mit ihrem Gesang, dass sie hier zu Hause sind und in ihrem Revier keine Artgenossen dulden. Erfahrene Ornithologinnen und Ornithologen machen sich diese Forschungsergebnisse zu Nutze, indem sie solche singenden Männchen aber auch Sichtbeobachtungen nach einer bestimmten Methode registrieren. Jedes singende Männchen lässt nun auf ein Revier schliessen. Durch mehrmaliges Begehen der Untersuchungsfläche während der Fortpflanzungszeit der Vögel kann die Erhebungsgenauigkeit verbessert werden. Dieses Vorgehen erlaubt es, dass man am Ende der Brutzeit relativ genaue Angaben zur Revierzahl von jeder Vogelart geliefert bekommt. Dies setzt jedoch voraus, dass die erfassende Person den Gesang und die verschiedenen Rufe jeder Vogelart genau kennt und sie bei Sichtkontakt zweifelsfrei bestimmen kann. Konzentriertes Arbeiten ist da gefragt.
| Brutpaare im Winterthurer Wald | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art | 2008 | 1988 | Trend Kanton Zürich | Lebensraum |
| Wespenbussard Pernis apivorus | 3 | 0 | + | Horstbäume im Waldinnern |
| Rotmilan Milvus milvus | 12 | 4 | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Habicht Accipiter gentilis | 2 | 1 | + | grosse Horstbäume im Waldinnern |
| Sperber Accipiter nisus | 9 | 3 | + | Stangengehölze im Waldinnern |
| Mäusebussard Buteo buteo | 37 | 27 | + | Generalist |
| Baumfalke Falco subbuteo | 5 | 2 | + | Exponierte Horstbäume im Wald |
| Hohltaube Columba oenas | 1 | 6 | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
| Ringeltaube Columba palumbus | 360 | 230 | + | Generalist |
| Waldkauz Strix aluco | 20 | 12 | +/– | Generalist |
| Grauspecht Picus canus | 2 | 5 | – | (Auen) Wälder mit Laubhölzern |
| Schwarzspecht Dryocopus martius | 19 | 9 | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht Dendrocopos major | 200 | 200 | +/– | Generalist |
| Mittelspecht Dendrocopus medius | 0 | 3 | + | Eichenreiche Wälder >3ha |
| Zaunkönig Troglodytes troglodytes | 740 | 630 | + | Generalist |
| Heckenbraunelle Prunella modularis | 170 | 180 | +/– | Generalist |
| Rotkehlchen Erithacus rubecula | 1400 | 1400 | +/– | Generalist |
| Singdrossel Turdus philomelos | 980 | 1200 | +/– | Generalist |
| Misteldrossel Turdus viscivorus | 76 | 61 | + | Generalist |
| Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix | 6 | 270 | – – | Buchen über grasigem Boden |
| Wintergoldhähnchen Regulus regulus | 560 | 1100 | +/– | Generalist |
| Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus | 1000 | 1800 | – | Generalist |
| Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca | 5 | 46 | – – | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Haubenmeise Parus cristatus | 23 | 9 | + | Generalist |
| Tannenmeise Parus ater | 580 | 930 | +/– | Generalist |
| Kleiber Sitta europaea | 390 | 400 | +/– | Alte Bäume |
| Waldbaumläufer Certhia familiaris | 89 | 80 | +/– | Generalist |
| Eichelhäher Garulus glandarius | 230 | 200 | +/– | Generalist |
| Dohle Corvus monedula | 9 | 19 | +/– | Nischen an Gebäuden, Bäume mit Schwarzspechthöhlen |
| Kolkrabe Corvus corax | 3 | 0 | ++ | überragende Horstbäume im Wald |
| Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra | 11 | 62 | – – | Generalist |
| Gimpel Pyrrhula pyrrhula | 27 | 41 | – | Generalist |
| Kernbeisser Coccothraustes | 20 | 78 | – | lichte Laubholzbestände |
| Alle Arten zusammen | 6983 | 9008 | ||
Die Veränderung des Bestands von einzelnen Arten ist zum Teil massiv und nicht in jedem Fall erklärbar. Da fallen zum Beispiel die Gewinner mit recht hohen Zunahmen auf. Bei den Greifvögeln sind es der Rotmilan und der Sperber. Ihr Brutbestand hat sich in den vergangenen 20 Jahren praktisch verdreifacht.
Der Rotmilanbestand folgt einem gesamtschweizerisch beobachteten Aufwärtstrend, der seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts anhält. Bis weit in die Voralpentäler hinein beobachtet man den Rotmilan heute auf der Nahrungssuche. Mit einer respektablen Flügelspannweite von stattlichen 1,60 m fliegt er gemessenen Fluges tief über die Dächer der Siedlungen und der Felder. Er ist sehr anpassungsfähig bei der Nahrungssuche. Diese besteht aus Kleinsäugern, auch Vögel, Aas und Abfälle verschmäht er nicht. Als sogenannter Ubiquist findet er in der Schweiz offensichtlich ihm zusagende Lebensbedingungen. Seinen Horst aus Reisigen baut er in Gehölzen, meist weit oben in den Kronen von Laub- und Nadelbäumen. Er ist ein Zugvogel, der in Südeuropa und in Nordafrika überwintert. Vermehrt bleiben heute viele Altvögel den Winter über in der Schweiz, während die diesjährigen Jungen in wärmere Gefilde wegziehen.

Der Sperber, der kleinste brütende Greif in der Schweiz, hat sich seit seinem Tiefstand Ende der sechziger Jahre recht gut erholt, nachdem das Versprühen gewisser persistenter Insektizide in der Landwirtschaft, wie zum Beispiel das DDT, verboten wurde. Als oberstes Glied in der Nahrungskette nahm er über seine Beutetiere so viel Gift in seinen Körper auf, dass sein Gelege zu dünne Eischalen aufwies, und deshalb zerbrach. In Winterthur leben heute mindestens 10 Paare. Es dürften aber eher mehr sein, denn er lebt während der Brutzeit sehr heimlich und ist deshalb ein schwieriger Kandidat zum erfassen.
Der Sperber ist ein geschickter wendiger Jäger und verschwindet so schnell zwischen den Bäumen und Häusern wie er gekommen ist. Ab und zu kreist er mit oder ohne Beute in die Höhe. Auffallend ist seine zügige und geradlinige Flugweise, bei der sich kurze schnelle Flügelschlagsequenzen mit längeren Gleitphasen abwechseln. Auf seinem Speisezettel stehen ausschliesslich Singvögeln, die er im Winter häufig auch im Siedlungsraum jagt. Bevorzugte Standorte für seinen Horst sind Nadelholzdickichte.

Ein weiterer Gewinner ist der Schwarzspecht, ein typischer Waldvogel, denn seine Bruthöhle und seine Nahrungsgründe liegen vorzugsweise im Wald. Das ganze Jahr über hört man im Forst seinen von weitem hörbaren Grügrügrü-Flugruf und den Gliüü-Ruf. Intensiv hört ihn die Waldbesucherin und der Waldbesucher im März und April, wo er an sonnigen Frühlingstagen seinen Balzruf, von weit her hörbar, zum besten gibt. Sein Vorkommen ist an grössere Waldkomplexe mit alten, starken, nicht zu dicht stehenden Bäumen gebunden. Er baut sich eine Höhle für die Kinderstube. Zu diesem Zweck sucht er sich in unserer Gegend fast ausschliesslich hochschaftige Buchen aus, die er relativ frei anfliegen kann.
Schwarzspecht profitiert vom Totholz

Von ihm beleben heute um die 20 Paare die Winterthurer Wälder, doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Wie ist eine solch hohe Zunahme zu erklären? Ein Grund dürfte sicher sein, dass die Förster heute Buchen mit Schwarzspechthöhlen, wenn betriebswirtschaftlich möglich, stehen lassen. Bekanntestes Beispiel dafür ist das Geissbühl, südwestlich angrenzend an den Tierpark Bruderhaus. Dort hat der Schwarzspecht im Laufe der Jahre mehrere Höhlen in diverse alte Buchen gezimmert. Davon profitieren heute die Dohlen und die Hohltauben, denn als Sekundärbewohner ziehen sie gerne in solche verlassene Brutstätten ein. Dies ist auch ein gelungenes Beispiel der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Forst-Fachleuten und dem Natur- und Vogelschutzverein Winterthur Seen.
Auch werden vermehrt abgestorbene Bäume stehen und Totholz liegen gelassen. Darauf findet der Specht Holz bewohnende Ameisen und andere Insekten. Die Bestandszunahme kann aber nicht allein mit der verbesserten Lebensgrundlage erklärt werden, denn dann hätte parallel dazu auch der häufigste Specht in unseren Wäldern, der Buntspecht, seinen Bestand vergrössern müssen. Mit etwa 200 Paaren ist sein Bestand aber stabil geblieben. Möglicherweise verzeichnete der Buntspecht bereits während der Bestandeserfassung von 1988 eine für ihn optimale Revierverteilung.

In der Tabelle 1 sind auch Verlierer auszumachen, deren markanter Rückgang nur schwer zu erklären ist. Zum Beispiel der Waldlaubsänger – ein Vertreter der Gattung der Zweigsänger – verzeichnete 1988 rund 270 Reviere. 2008 dürften es noch rund 6 Reviere gewesen sein und heute brütet er kaum mehr in unseren Wäldern. Aus vielen Gebieten des Mittellandes ist er verschwunden. Mit seinem auffallenden Gesang und dem Balzflug in den Baumkronen belebt der Waldlaubsänger unsere buchenreichen Laubwälder, zu deren lichtgrünem Laub sein lebhaft gelbgrünes Gefieder bestens passt. Das Nest – ein kunstvoller Kugelbau aus Halmen – errichtet er am Boden.
Die Einflussfaktoren, die zu diesem drastischen Rückgang führen, sind sehr komplex und werden wissenschaftlich untersucht. Die Zusammensetzung der Baumarten hat sich zwar in den letzten 20 Jahren Richtung Laubwald, d. h. zu Gunsten seiner Ansprüche an den Lebensraum verändert. Die Bodenvegetation hat sich aber zum Teil von einer gering ausgebildeten Kraut- und Strauchschicht hin zu einer mastigeren Vegetation, hauptsächlich hin zu gebietsweise geschlossenen Brombeerteppichen entwickelt. Dies als Folge des zu hohen Stickstoffeintrags aus der Luft, verursacht durch die Verbrennungsmotoren von Autos, Maschinen und Traktoren sowie durch die Heizungen. Dies dürfte aber nur eine der Ursachen für seinen massiven Rückgang sein. Es werden auch ungünstige Einflüsse auf dem Zugweg und im Überwinterungsgebiet südlich der Sahara vermutet.

Ein weiterer Kummervogel ist der Trauerschnäpper. Seinen Namen dürfte er wegen dem schwarz befrackten weissen Kleid des Männchens bekommen haben. Er ist wie der Waldlaubsänger ein Langstreckenzieher , der im tropischen Afrika überwintert. Mit fünf Paaren beträgt sein Bestand gerade noch etwa 10% im Vergleich zu 1988. Innerhalb der Schweiz ist vor allem der Kanton Zürich von seinem Rückgang betroffen. Was ist mit ihm geschehen? An der Waldstruktur kann es kaum liegen, denn diese entspricht heute mit ihrem erhöhten Laubholzanteil und den lichten Waldpartien eher seinen Habitatswünschen als die früheren Nadelholzforste. Die Schweiz liegt allerdings an der südlichen Verbreitungsgrenze des Trauerschnäppers. Hat er eventuell wegen der Erderwärmung sein Verbreitungsgebiet etwas nach Norden verschoben? Oder ist es einfach eine naturbedingte Fluktuation, von der wir erwarten dürfen, dass der Tiefstand nach einigen Jahren oder Jahrzehnten vorbei ist, und der sympathische Kleinvogel in unseren Wäldern wieder heimisch wird? Bekannt ist nämlich, dass der Trauerschnäpper vor 1920 in der Schweiz nicht vorkam.
Da der Trauerschnäpper erst Ende April/Anfang Mai ins Brutgebiet zurück kehrt , sind seine Bruthöhlen meistens schon durch andere gefiederte Waldbewohner, hauptsächlich von Meisen besetzt. Er weiss sich zwar gegen die unerwünschten «Hausbesetzer» energisch zu wehren. Nichts destotrotz haben die Natur- und Vogelschutzvereine unter der Initiative des Forstbetriebs im Jahr 2012 eine Ansiedlungs-Aktion gestartet. Dabei werden an geeigneten Standorten jeweils erst Ende April Nistkästen für diese Spätankömmlinge aufgehängt. 2012 wohnte wenigstens 1 Paar im Ohrbühlwald in einem der aufgehängten Nistkasten und schritt dort auch zur Brut. Nach wenigen Jahren wird sich dann zeigen, ob diese Unterstützungsmassnahmen dem Trauerschnäpper eine Hilfe sind.

Der Rückgang bei den Winter- und Sommergoldhähnchen aber auch beim Fichtenkreuzschnabel ist zum Teil verständlich. Als reine Nadelwaldbewohner profitieren sie nicht vom flächenmässig zunehmenden Mischwaldbestand. Dies allein erklärt die hohen Verluste jedoch nicht. Unbekannte Einflussfaktoren scheinen auch hier zu wirken.
Veränderungen im Brutbestand unterliegen selbstverständlich natürlichen Fluktuationen. Die Faktoren, die die Bestandsentwicklung beeinflussen, sind äusserst komplex. Es gibt selten nur einen Grund, weshalb der Brutbestand einer Vogelart zu- oder abnimmt. Einflüsse wie das Nahrungsangebot, der Wetterverlauf der vorjährigen Brutsaison oder die Härte des zurückliegenden Winters können da einwirken. Bei den ziehenden Arten spielen zusätzliche Einflüsse auf dem Zugweg und im Überwinterungsgebiet eine entscheidende Rolle. Auch werden in den südlichen EU-Ländern noch stets Zugvögel gejagt, obwohl dies in der Europäischen Union schon seit Jahren gesetzlich verboten ist. Weitere bestimmende Faktoren, die den Bestand massgebend regulieren, liegen zum Beispiel auch in der Biologie jeder einzelnen Vogelart selber.
Anlass zu Bedenken gibt uns der Vergleich des Gesamtbestandes am Ende der Tabelle 1 trotzdem. Warum hat die Zahl der Brutpaare während den vergangenen zwanzig Jahren derart stark von rund 9000 auf 7000 respektive um ganze 22% abgenommen? Einzelne Arten mögen zwar einer gewissen Fluktuation unterliegen, die Gesamtzahl aller Arten dürfte jedoch niemals so stark schwanken. Reagieren die Vögel und die Lebensgemeinschaften, die mit ihnen zusammenhängen, doch sensibler auf die, durch die Menschheit verursachten Umwelteinflüsse, als man gemeinhin annimmt?
Vögel mit kantonalem Verbreitungsschwerpunkt in den Winterthurer Wäldern
Innerhalb des Kantons Zürich haben einige Vogelarten ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Wäldern von Winterthur. Sie sind in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt. Gemessen am Gesamtbestand im Kanton Zürich beträgt ihr Anteil beachtliche 5 bis 8%. Für dieses knappe Dutzend Wald-Arten trägt die Stadt Winterthur eine besondere Verantwortung. Es fällt auf, dass nur die Dohle ein Vogel ist, der in Höhlungen nistet. Alle andern Vogelarten sind Freibrüter, die ihre Nester oder Horste im Geäst von Sträuchern und Bäumen bauen. Der zunehmend struktur- und artenreicher werdende Winterthurer Wald bietet für ihren Fortbestand gute Voraussetzungen.
| Brutpaare im Kanton Zürich 2008 | Brutpaare in Winterthur 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Anzahl | Anzahl | in % |
| Baumfalke Falco subbuteo | 79 | 5 | 6,3 |
| Ringeltaube Columba palumbus | 7400 | 360 | 4,8 |
| Zaunkönig Troglodytes troglodytes | 13’000 | 740 | 5,7 |
| Heckenbraunelle Prunella modularis | 2700 | 170 | 6,3 |
| Singdrossel Turdus philomelos | 20’000 | 980 | 4,9 |
| Misteldrossel Turdus viscivorus | 1600 | 76 | 4,8 |
| Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus | 20’000 | 1000 | 5 |
| Dohle Corvus monedula | 140 | 9 | 6,2 |
| Eichelhäher Garulus glandarius | 4300 | 230 | 5,3 |
| Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra | 160 | 11 | 6,9 |
| Gimpel Pyrrhula pyrrhula | 340 | 27 | 7,9 |
Literaturangaben
- Burkhart, M./P. Horch/H. Schmid/F. Tobler (2004): Vögel – unsere Nachbarn: Wie sie leben, was sie brauchen. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- Hagemeijer, W J M/M J Blair (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London.
- Keller, Robert Dr. (1932): Die Vögel der Lokalfauna von Winterthur. Beilage zum 17. Bericht an die Mitglieder der Museumsgesellschaft Winterthur.
- Knaus, P./R. Graf, J. Guélat, V. Keller, H. Schmid, N. Zbinden (2011): Historischer Brutvogelatlas. Die Verbreitung der Schweizer Brutvögel seit 1950. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- Maumary, L./L. Vallotton/P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- Miranda, B./M. Bürgi (2005): Spechte – anspruchsvolle Waldbewohner. Merkblatt für die Praxis: Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf.
- Schmid, H./R. Luder/B. Naef-Daenzer/R. Graf/N. Zbinden (1988): Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein 1993–1996.
- Schmid, H./M. Burkhardt/V. Keller/P. Knaus/B. Volet/N. Zbinden (2001): Die Entwicklung der Vogelwelt in der Schweiz. Avifauna Report Sempach. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- Weggler, M./C. Baumberger/M. Widmer/Y. Schwarzenbach/R. Bänziger (2009): Zürcher Brutvogelatlas 2008 Aktuelle Brutvogelbestände im Kanton Zürich 2008 und Veränderungen seit 1988. Herausgeber: ZVS/BirdLife Zürich.
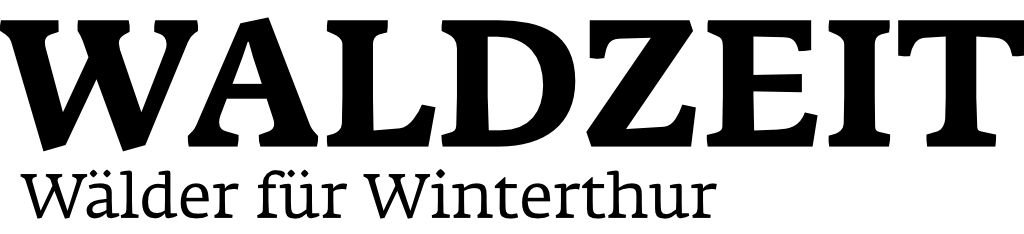
Schreibe einen Kommentar