Haselmaus
Lebensraum und Lebensgewohnheiten
Begegnungen mit Haselmäusen gehören schon nicht zum Alltäglichen. Umso mehr freut es uns, wenn wir beim Durchstöbern buschiger Waldränder plötzlich vor einem kugeligen, kunstvoll mit Gräsern verarbeiteten Nest stehen, das knapp zwei Meter über dem Boden zwischen kleinen Ästen eines Strauches befestigt ist. Wir nähern uns langsam und merken bald, dass hier keine Vögel nisten. Das Nest scheint eine vollkommen geschlossene Hohlkugel zu sein.
Von der Neugierde gepackt, drücken wir sorgfältig einige Äste zur Seite, und schon huschen drei, vier kleine, rotbraune Haarknäuelchen nebst einem grösseren aus dem kaum sichtbaren, seitlichen Loch des Nestes. Die Haselmausmutter und ihre Jungen flüchten vor einem unbekannten Feind, der ihre Wohnung erschüttert, anders, als dies der Wind tut. Sie springen nicht weit weg, aber die kurzen Strecken legen sie mit traumwandlerischer Sicherheit zurück. Über dünnste Zweige, ja sogar über Blattstiele und Blätter springen sie in die nächste Deckung. Es sind wahre Seiltänzer.
Nur wer jetzt eine halbe Stunde still stehen kann, wird die Tiere nicht aus den Augen verlieren. Die Haselmäuse äugen aufmerksam nach dem Störefried, und die zierlichen, runden Ohren sind auch stets in Bewegung. Ab und zu vernehmen wir ein ganz hohes Piepsen. Die Töne liegen an der Schallgrenze unserer Ohren und darüber, also zum Teil im Ultraschallbereich.






Wenn sich die Tiere sicher fühlen, beginnen sie an einer Knospe zu knabbern oder aus einem Blatt winzig kleine Löcher herauszubeissen. Beim genauen Hinsehen gleichen grosse Teile des Buschblätterdaches über dem Nest einem feinen Sieb. Lange dauert aber diese Mahlzeit nicht; bald trachten die Haselmäuse wieder danach, zu ihrem Nest zu gelangen, wo sie den Rest des Tages verschlafen wollen. Sie gehören nämlich zu den Dämmerungs- und Nachttieren und verlassen tagsüber die Schlafstube nur bei vermeintlicher oder wirklicher Gefahr. Diese Tatsache ist sicher auch der Hauptgrund, warum wir sie nur selten zu Gesicht bekommen und gar nicht so viel über sie wissen. Ähnliches gilt auch für ihre Verwandten, die Garten-, Baum- und Siebenschläfer. Mit diesen zusammen gehören die Haselmäuse zur Nagetierfamilie der Schläfer oder Bilche.
Winterschlaf
Die Haselmäuse gehören zu den echten Winterschläfern. Im Spätherbst legen sie in hohlen Baumstümpfen, unter grossen Steinen, in lockerem Mauerwerk oder gar nur in Bodenvertiefungen ein äusserst sorgfältiges Winternest an. Faseriges Material verschiedenster Pflanzen wird mit dem klebrigen Speichel verkittet und das Innere mit Laub, Gras und Moos ausgepolstert. Mitte Oktober verfallen sie dann in einen tiefen Winterschlaf, den sie in der Regel wenig unterbrechen. Oft liegen mehrere Tiere beieinander. Alle sind fast kugelrund zusammengerollt, haben die Vorderpfoten ans Gesicht gepresst und den Schwanz dazwischen über das Köpfchen gelegt.
Der Winterschlaf ist nur bei Tieren möglich, die in der Lage sind, ihre Wärmeregulation umzuschalten. Das können allerdings nur wenige. Die anderen Tiere gleichen tiefe Aussentemperaturen durch gesteigerte Atmung und erhöhten Nahrungsverbrauch, zum Teil auch durch Anzehren ihrer Fettreserven aus. Sind dann die im Körper gespeicherten Vorräte erschöpft, so erkalten sie langsam. Sinkt die Körpertemperatur auf etwa 20 Grad ab, so arbeiten bestimmte Teile des Gehirns nicht mehr, und der Tod tritt ein.
Die echten Winterschläfer gleichen tiefe Aussentemperaturen zuerst auch durch vermehrte Atmung und durch grösseren Nahrungsverbrauch aus. Wird es aber immer kälter, so sind sie in der Lage, auch ihre Körpertemperatur absinken zu lassen. Dabei fallen sie in einen tiefen Schlaf, der mit einer todesähnlichen Starre verbunden ist. So atmet jetzt auch die Haselmaus viele Male langsamer, ihr Herz schlägt nur noch ein paarmal pro Minute, und ihr Blut-druck sinkt erheblich. Aber auch bei Winterschläfern darf die Körpertemperatur nicht beliebig weit absinken. Wenn sie eine untere Grenze von etwa fünf Grad erreicht, wird es selbst für diese Tiere gefährlich. Sie erliegen aber dem Kältetod nicht, wenn ihr «Temperaturfühler» schnellere Herz- und Atemtätigkeiten auslöst, die die Tiere wieder aufwärmen oder gar wecken, damit sie einen geschützteren Ort aufsuchen können. Auch bei günstigen Bedingungen schläft kein Tier den ganzen Winter pausenlos durch. So weiss man vom Murmeltier, dass es während seines gut fünfmonatigen Winterschlafes etwa sechsmal aufwacht.
Aufzucht der Jungen
Im Monat April weckt die wieder stärker wärmende Sonne unsere Haselmäuse. In dieser Jahreszeit kann man sie auch am besten beobachten, denn ihr Lebensraum, die niederen Büsche, sind noch laubfrei. Sie beginnen bald mit dem Bau eines Sommernestes, in welchem einige Wochen später die ersten 3–7 Jungen zur Welt kommen. Diese sind anfänglich noch nackt und blind, werden etwa einen Monat lang gesäugt, wachsen dann aber rasch und sind bereits im Spätsommer selbständig. Zu dieser Zeit werfen deren Mütter meistens noch einmal 3–5 Junge. Im Herbst ist ja der Tisch reich gedeckt mit Samen, Obst, Beeren und Insekten aller Art, so dass auch der zweite Wurf bis zum Einbruch des Winters genügend Reserven anlegen kann. Ganz besonders schätzen die Tiere die Haselnüsse, die sie in der Regel aufraspeln und leeren, ohne sie abzupflücken.
Lebensraum und Fortpflanzung der Haselmäuse
Nest
Die Haselmaus baut ihr kugeliges, kunstvoll geflochtenes Nest in reich verzweigten Sträuchern, die an geschützten und wenig begangenen Waldrändern liegen. Sie steigt dazu 2–3 m über den Boden und verwendet als Baumaterialien dürres Laub, Moos und Gras. Haselmausnester sind oben immer zu; der Eingang liegt auf der am meisten geschützten Seite.
Fortpflanzung
Das Nest dient in erster Linie für die Aufzucht der 3–4 Jungen, die nach einer Tragzeit von 25 Tagen Ende Mai, anfangs Juni auf die Welt kommen. In günstigen Jahren wirft die Mutter im Herbst noch ein zweites Mal.
Nach 18 Tagen öffnen die Kinder ihre Augen. Sie werden etwa einen Monat lang gesäugt und machen sich dann nach einem weiteren Monat selbständig. Bereits im nächsten Sommer sind sie geschlechtsreif und leben dann noch etwa 2–3 Jahre.
Lebensgewohnheiten der Haselmäuse
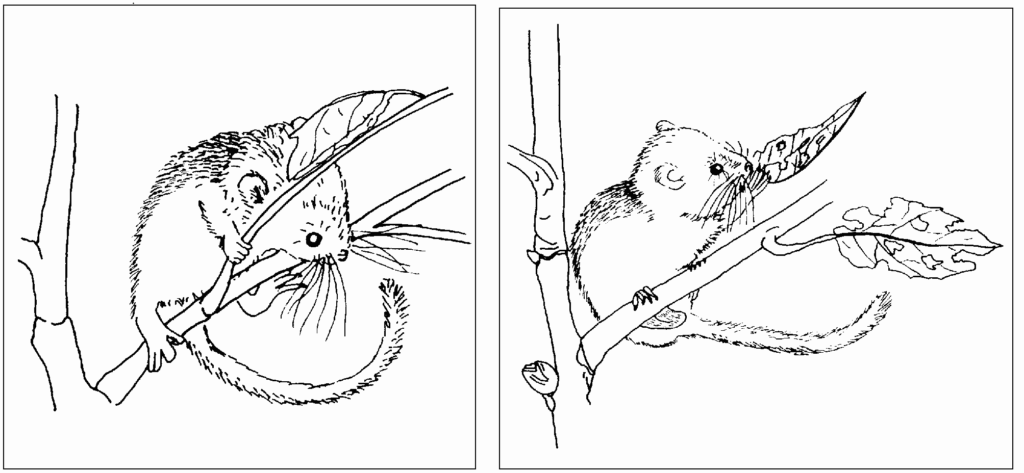
Nächtliche Lebensweise
Haselmäuse sind Dämmerungs- und Nachttiere und verlassen ihre Nester tagsüber nur bei drohender Gefahr. Sie bewegen sich mit traumwandlerischer Sicherheit auch über dünne Äste und selbst über Blätter.
Nahrung
Sie fressen Beeren, Sämereien, Haselnüsse, Knospen, feine Rindenteile und gelegentlich auch kleine Insekten. Sie verraten ihren Neststandort vielfach, weil sie aus den Blättern der näheren Umgebung siebartig Löcher herausraspeln.
Überwinterung
Haselmäuse überwintern in Baumhöhlen, unter grösseren Steinen oder in lockerem Mauerwerk. Sie bauen sich ein äusserst sorgfältig abgedichtetes Winternest und rollen sich darin kugelartig ein, pressen die Vorderpfoten ans Gesicht und legen den Schwanz dazwischen über den Kopf.
Waldmaus

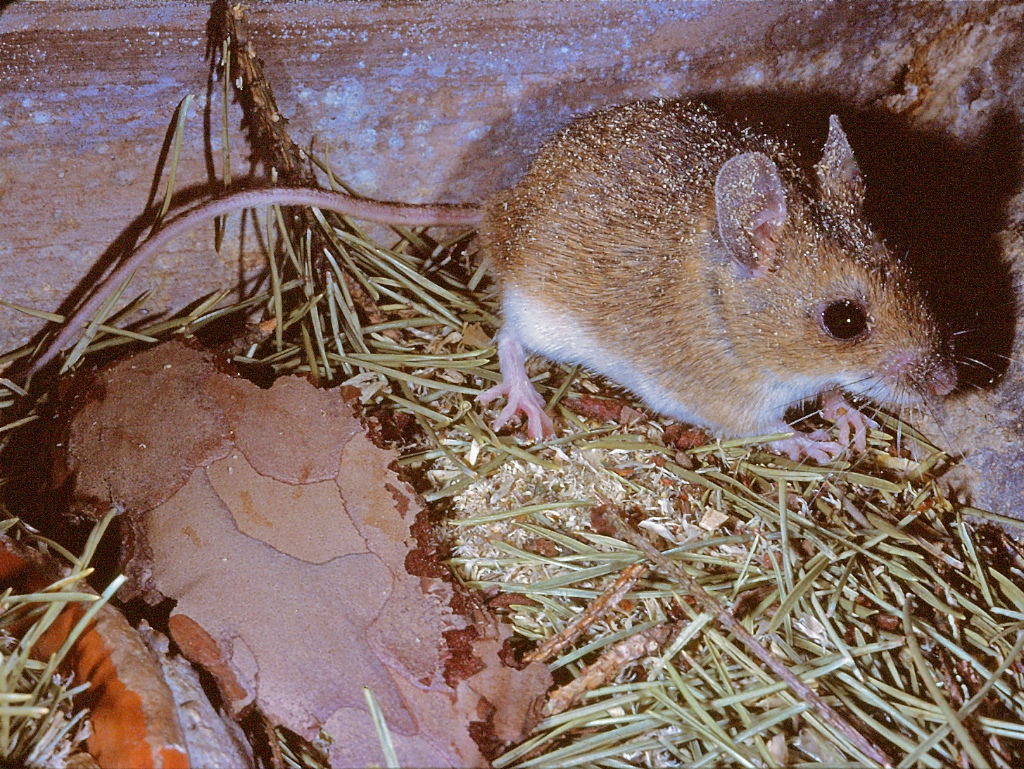
Siebenschläfer
Der Siebenschläfer gehört, zusammen mit der zierlichen Haselmaus, dem Garten- und dem Baumschläfer, zur Familie der Bilche oder Schläfer. Er trägt seinen Namen zu Recht, verbringt er doch rund sieben Monate im Winterschlaf, den er allerdings ab und zu unterbricht.






Lebensraum
Vom Mai an bis in den Herbst hinein finden wir den Siebenschläfer in Laubmischwäldern, vor allem in Eichenbeständen. Wenn wir gerne einmal einen solchen Graupelz als «Haustier» halten möchten, stellen wir uns im Spätsommer bei einem Vogelschutzverein zur Verfügung, um im Wald Vogelnistkästen putzen zu helfen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit finden wir dann einen dieser Untermieter schlafend auf dem Nistkastenboden hockend oder wie einen schimpfenden, brummenden Teufel den Zugriff verwehrend. Man hüte sich, alte Siebenschläfer anzufassen. Sie beissen unsere Finger glatt durch! Jungtiere, die man auf diese Weise im August oder gar anfangs September noch reichlich findet, sind hingegen völlig harmlos.
Körperbau
Siebenschläfer sind im Vergleich mit den Haselmäusen recht stattliche Tiere. Sie erreichen mit dem buschig behaarten Schwanz zusammen etwa 30 cm und wiegen im Sommer um die 100 Gramm. Wenn es auf den Winter zugeht, sind sie dank dem Speicherfett fast doppelt so schwer. Sie besitzen ein überaus feines Gehör. Wenn sie lauschen, kippen sie die Ohrmuscheln abwechselnd nach vorn, und zwar zweimal pro Sekunde. Auch das Geruchsvermögen ist sehr gut entwickelt und gestattet das Wahrnehmen von Früchten auf recht grosse Distanzen. Die besten Leistungen erbringt aber der Tastsinn. Mit den bis zu 6 cm langen Schnurrhaaren tastet das Nachttier die Gegenstände ab, während sich die Nase schnuppernd bewegt. Durch das rasche Einziehen der Luft entsteht oft ein leises Piepsen.
Als ausgesprochenes Baumtier kann der Siebenschläfer sehr wendig klettern und Sprünge bis zu einem Meter bewältigen. Die spitzen Krallen und die klebrige Ausscheidung der Sohlen sind ihm dabei eine wichtige Hilfe. Der Schwanz dient bei all den Klettereien und Sprüngen, aber auch beim Sitzen als Balancierstange.
Wochenstube
Leider können wir die Geburt und die Kinderstube der kleinen Siebenschläfer nicht ohne weiteres beobachten. Nach einer Tragzeit von einem Monat werden drei bis zehn nackte und blinde Junge geboren. Die Mutter bringt sie in einer von ihr zurechtgerichteten und mit Laub und Heu ausgepolsterten Höhle unter einem Baumstrunk, in einer Felsspalte, in einer Baumhöhle oder in einem Vogelnistkasten zur Welt und säugt sie mindestens drei Wochen lang. Dazu sitzt sie breitbeinig über ihre auf dem Rücken liegenden Jungen. Nach gut zwei Wochen sind die Kinder behaart, nach einer weiteren Woche öffnen sie die Augen, und bald nachher beginnen sie in der näheren Umgebung des Nestes herumzuklettern. Vielfach bleibt die Familie, allerdings meist ohne den Vater, bis zum nächsten Sommer beieinander.
Winterschlaf
Für den Winterschlaf graben sich die meisten Bilche mindestens einen halben Meter tief ins Erdreich ein. Die bequemen unter ihnen nehmen mit einer gut geschützten Felsspalte, einem ausgefaulten Astloch oder mit dem Dachboden eines waldnahen Gebäudes vorlieb. Sie rollen sich so zusammen, dass der Schwanz über den Kopf zu liegen kommt und klappen die Ohrmuscheln über den Gehörgang. Mit der verkleinerten Oberfläche sparen sie soviel Energie wie möglich. Die «Heizung» kann auf Sparflamme brennen, und so reichen die Fettvorräte bis zum nächsten Frühjahr. In Gefangenschaft braucht der Sieben-schläfer nicht unbedingt einen sieben Monate lang dauernden Winterschlaf. Man sollte ihn aber doch mindestens zwei Monate lang bei einer Temperatur zwischen 0–4 Grad Celsius halten, weil er so älter wird, als wenn man ihn nicht winterschlafen lässt. Für die kurzen Aufwachperioden stellt man ihm einige unverderbliche Nahrungsvorräte in den Käfig. Hält man ihn in einem mehr oder weniger geheizten Raum, so bleibt er wach. In diesem Fall braucht er jeden Tag Futter und natürlich auch zu trinken.
Lebenserwartung
In der freien Natur liegt die durchschnittliche Lebenserwartung des Siebenschläfers bei 6 Jahren. Unter besten Bedingungen erreicht er ein Alter von höchstens 8–10 Jahren.
Siebenschläfer sind drollige Nagetiere
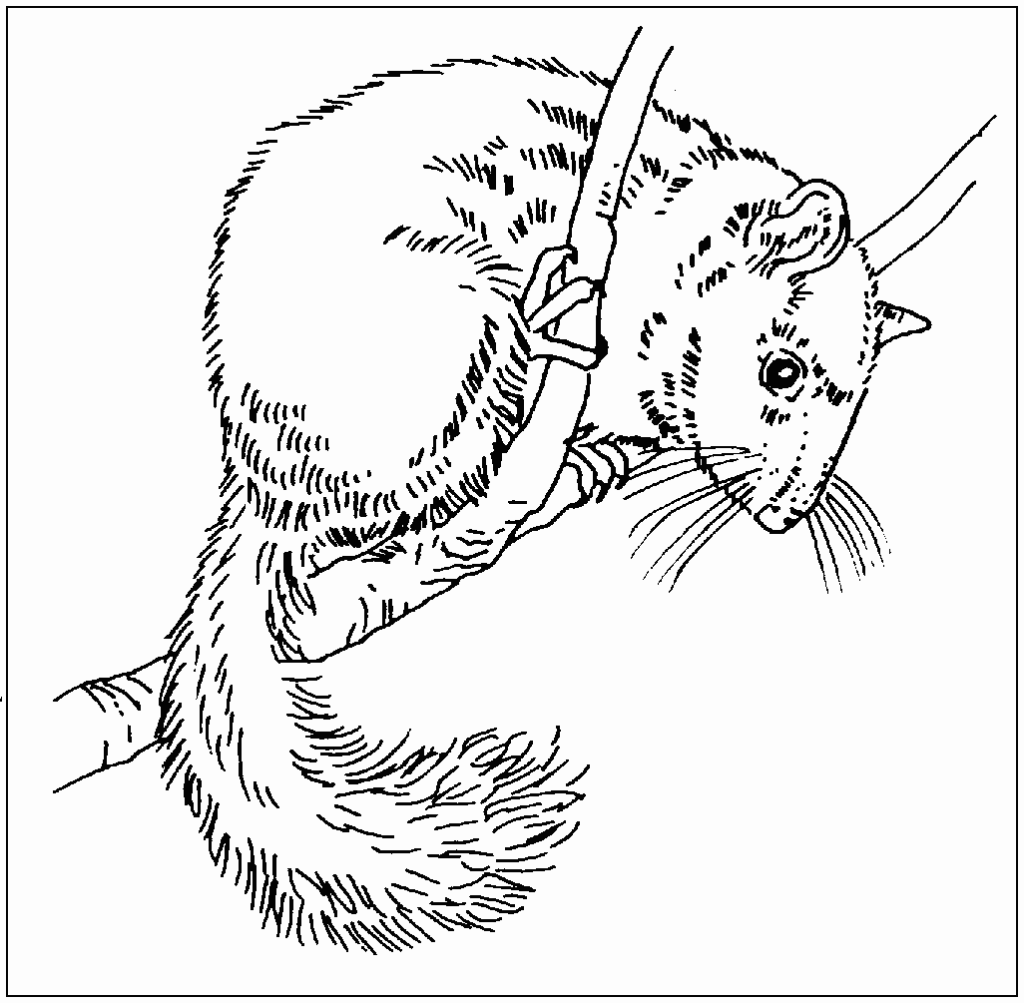
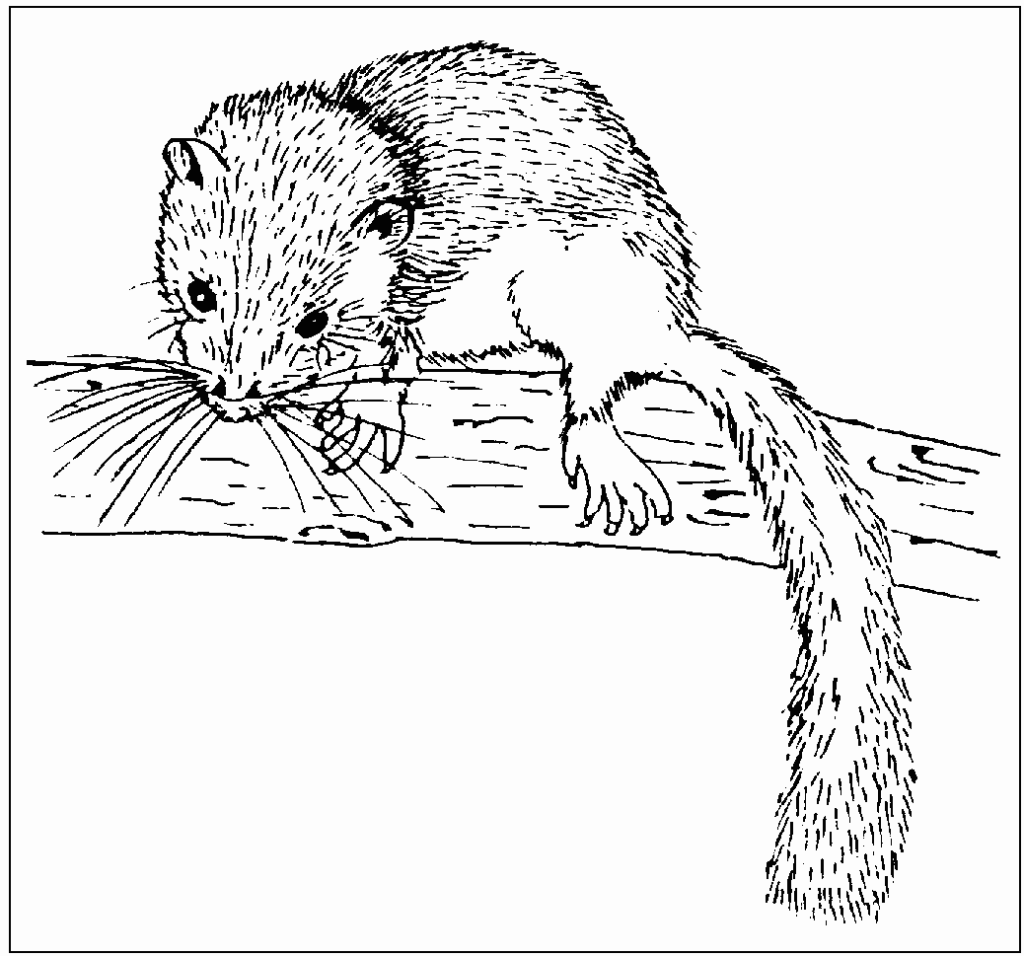
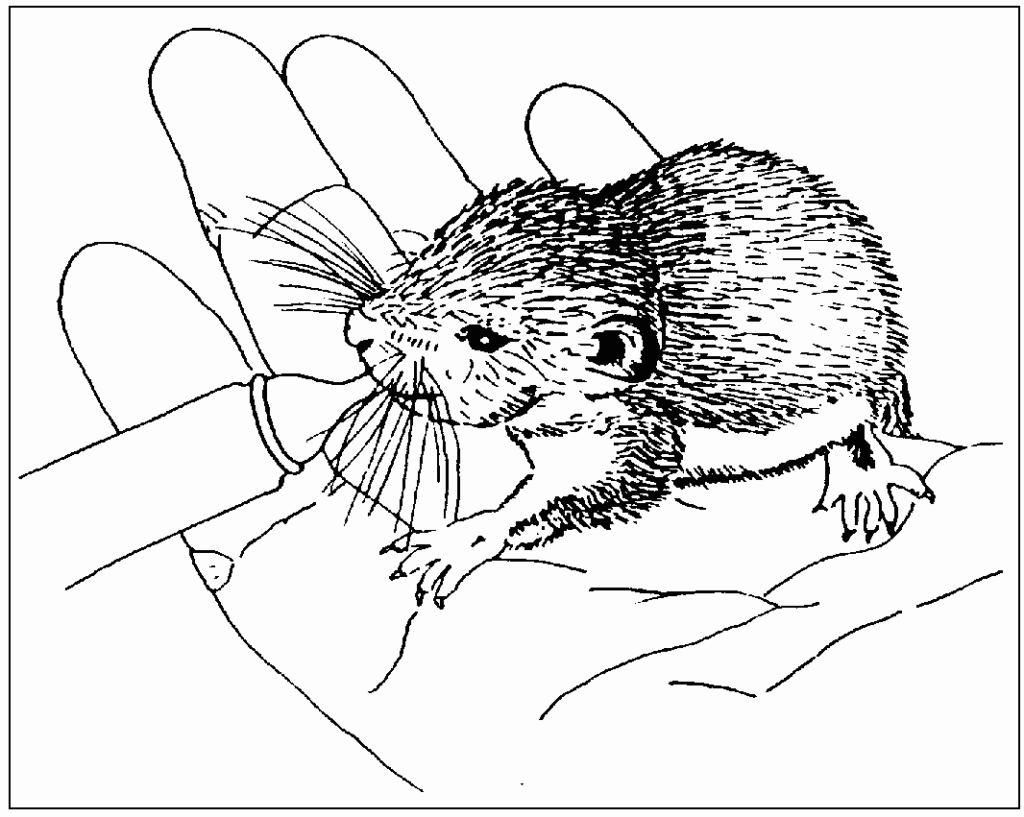
Schlaf- und Ruhestellen des Siebenschläfers
- Die meisten Nester der Siebenschläfer finden wir auf Bäumen. Gelegentlich bezieht er ein verlassenes Vogelnest, das er zu einer weich und warm gepolsterten Kugel ausbaut.
- Er benützt nicht ungern leere Spechthöhlen, nimmt aber ab und zu auch einmal mit einem geeigneten Hohlraum unter einem Wurzelstrunk vorlieb.
- Für die Aufzucht seiner bis zehn Kinder belegt der Siebenschläfer nicht ungern einen freien Nistkasten. Beim Öffnen dieser Wohnungen ist Vorsicht geboten: Die Mutter beisst sehr schnell und kräftig in unsere Finger. Die Jungen sind hingegen völlig harmlos.
Zur Lebensweise der Siebenschläfer
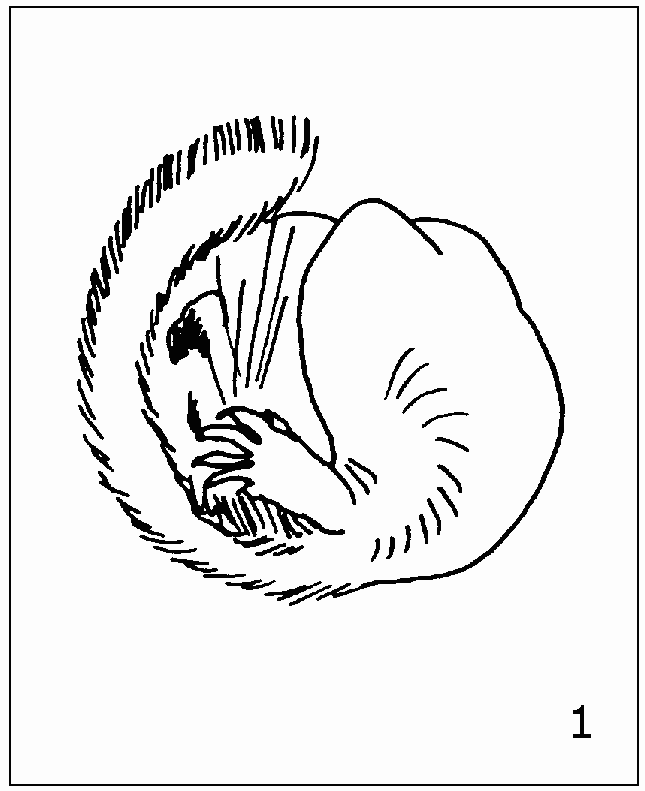
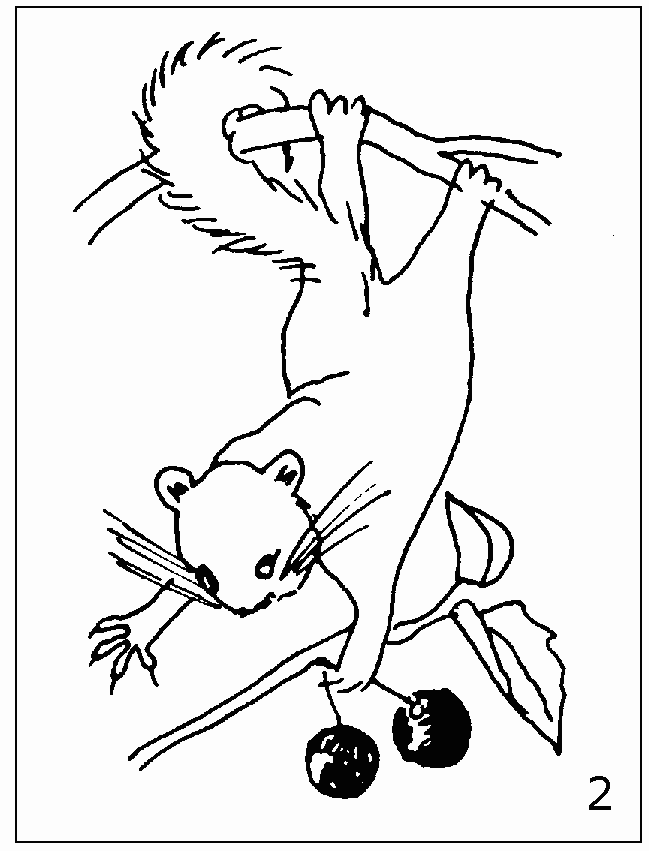
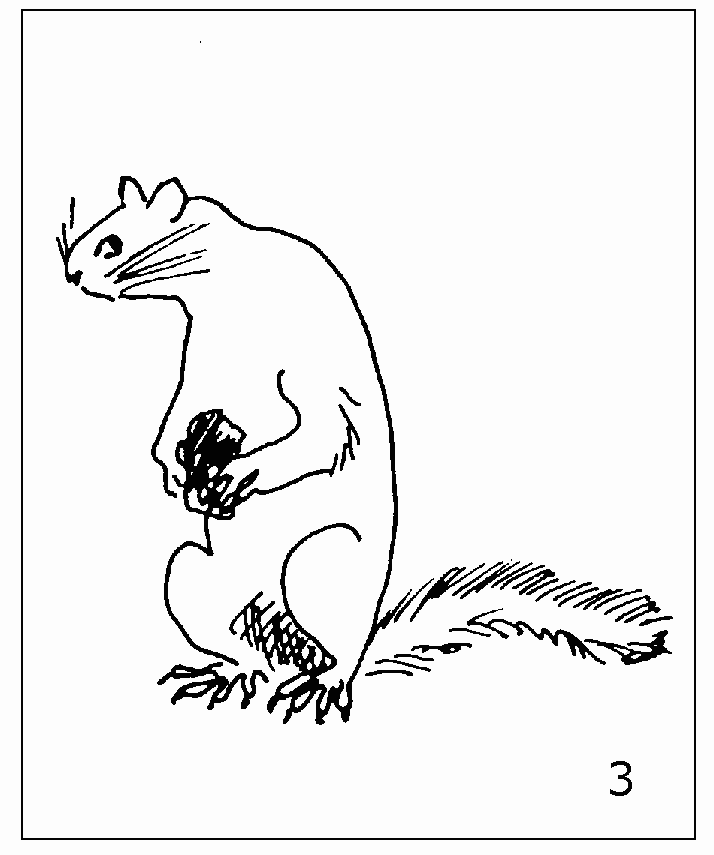
- Der Siebenschläfer ist ein ausgesprochenes Nachttier. Er schläft tagsüber, indem er sich einrollt und seinen langen Schwanz als Kopfpelz benützt. Für den langen Winterschlaf klappt er dann zusätzlich noch die Ohrmuscheln nach vorn.
- Der Siebenschläfer kann als Baumtier sehr wendig klettern und bis 1 m weit springen. Der Schwanz dient als Balancierstange, und mit den spitzen Krallen und den klebrigen Sohlen hält er sich fast überall fest.
- In der Nacht geht er auf Nahrungssuche. Dank seinem hervorragenden Geruchssinn nimmt er Essbares auf grosse Distanzen wahr. Für die Nahorientierung dienen die bis 6 cm langen Schnurrhaare als Tastorgane.
Igel
Es ist schade, dass wir diese drolligen Stachelknäuel so schlecht kennen. Wohl sehen wir hie und da einen Igel im Scheinwerferlicht eines Autos, wenn er auf der Strasse nach Insekten Ausschau hält. Vielleicht bleibt aber für viele von uns nur eine Begegnung aus der Kinderzeit haften: Igel trinken gerne Milch aus einem alten Suppenteller (was übrigens mit Sicherheit Durchfall erzeugt!) und verschwinden hurtig in der Dunkelheit, wenn sie gestört werden.










Urtümliche Tiere
Dämmerungs- und Nachttiere sind natürlich auch viel schwieriger zu beobachten, und das mag der Grund sein, dass wir auch über den Igel lange so wenig wussten. Allerdings können wir schon in alten Tierbüchern gar manche Seiten über ihn nachlesen und vernehmen da ganz sonderbare Dinge:
… denn sie wöltzen sich auff öpffeln, so unter den Bäumen ligen …. und ziehen damit in die holen Bäum in jihre Nester.
Diese unwahre Geschichte, wonach die Igel mit ihren Stacheln Äpfel aufspiessen und als Vorräte in ihre Nester tragen würden, ist bald 2000 Jahre alt und wurde selbst vom guten alten Brehm getreulich nacherzählt.
Igel sind sehr urtümliche Tiere, und sie haben ihre Gestalt und ihre Lebensweise auch seit vielen Millionen Jahren nicht stark verändert. Ihr Stammbaum reicht über 60 Millionen Jahre zurück, was immerhin bedeutet, dass er rund 30mal älter ist als das Menschengeschlecht. Es gilt als erwiesen, dass ursprünglich gebliebene Tierarten grosse Überlebenschancen besitzen, weil sie sich nicht einseitig entwickelt haben und darum auch grossen Umweltveränderungen gut gewachsen sind.
Feinde
Der Igel hat nicht viele Feinde, wenn wir zunächst einmal von den Menschen und ihrer Technik absehen wollen. Am ehesten hat er sich vor grossen Nachtraubvögeln wie dem Uhu und den Käuzen in acht zu nehmen, bisweilen können ihm aber auch Füchse, Iltisse, Dachse und Hunde nachstellen. Aber alle diese Feinde zusammen vermögen ihn nie so zu dezimieren wie die Menschen mit ihren Autos. Der Igel sucht nämlich als ausgesprochen wärmeliebender Insektenfresser seine Beute sehr gern auf Strassen, die tagsüber Wärme speichern und dann während der Nacht von Insekten aufgesucht werden. Dieses Verhalten wird vielen zum Verhängnis. So weiss man, dass schon vor 20 Jahren, bei weit geringerem Autoverkehr als heute, pro Jahr und pro 100 km Strasse mehr als 500 Igel überfahren worden sind. Heute mögen es mindestens dreimal mehr sein. Dazu vergiften wir noch viele andere Igel, indem wir Schnecken und Insekten mit hochgradig giftigen Körnern oder Spritzmitteln bekämpfen. Viele dieser toten Tiere werden dann von Igeln gefressen. Wohl ertragen sie weit grössere Giftmengen, als wir annehmen, aber trotzdem sterben nicht wenige einen jammervollen Tod.
Kinderstube
Nach einer Tragzeit von 5–6 Wochen bringt die Igelmutter im Mai oder Juni und viel- leicht noch ein zweites Mal im August oder September 5–7 Kinder zur Welt. Die Neugeborenen sind 5–9 cm lang und wiegen nur 12–25 Gramm. Nachdem das letzte Kind geboren worden ist, packt die Mutter ein jedes mit dem Maul, um es an ihren Bauch zu legen. Dort suchen sie die Zitzen und beginnen zu trinken.
Die Frischgeborenen besitzen eine rosarote Unterseite und einen grauen Rücken. Die Haut ist prall mit Wasser gefüllt und liegt straff um den Körper. Die weissen, harten Stacheln liegen zunächst noch wie versunken in einem Polster. So konnten sie die Mutter bei der Geburt nicht verletzen. Schon nach einem Tag hat die Haut so viel Wasser verloren, dass die Erstlingsstacheln bereits sechs Millimeter aus der faltig gewordenen Haut ragen, am zweiten oder dritten Tag erscheinen dann die Spitzen der dunkel und hell geringelten Stacheln der zweiten Serie.
Die kleinen Stachelknäuel können während der ersten beiden Wochen weder sehen noch hören und verschlafen einen Grossteil der Zeit. Wenn sie Hunger haben, können sie aber recht lebhaft werden, und schon bald verdrängen die aktiveren ihre duldsameren Geschwister von den besten Zitzen. Dazu setzen sie ihre Füsse und gelegentlich auch ruckartige Stösse mit ihrem Stachelkleid ein. Die Mutter liegt während des ganzen Gerangels mit völlig entspannter Muskulatur auf einer Körperseite und scheint zu schlafen. Normalerweise lässt sie ihre Kinder etwa eine halbe Stunde lang trinken, werden die Streitereien um die beste Zapfstelle aber zu heftig, so steht sie einfach auf und läuft vielleicht sogar weg.
In der dritten Woche öffnen sich Ohren und Augen der Igelkinder. Sie sind jetzt auch voll behaart und bestachelt. Die Mutter nimmt sie immer häufiger auf ihre Beutezüge mit und achtet streng darauf, dass keines eigene Wege geht. Hat eines dennoch den Anschluss verloren, so pfeift es zwitschernd. Die Mutter eilt herbei, beschnuppert ihr Kind und schubst es wieder auf den zu beschreitenden Pfad.
Nach sechs Wochen verlieren die jungen Igel allmählich ihre Erstlingsstacheln. Mit dem Stossen der endgültigen Stacheln ist dann die Kleinkinderzeit abgeschlossen, und es geht gar nicht mehr so lange, bis die Mutter die selbständig gewordenen Jungen aus der gemeinsamen Wohnung vertreibt.
Sinnesleistungen und Reaktionsvermögen
Der Igel ist kein besonders schlaues Tier, wie er in Märchen oder dem eingangs erzählten Geschichtchen dargestellt wird. Auch sieht er nicht besonders gut und besitzt ein eher schwaches Herz, was ihm auch eine Flucht vor Feinden verunmöglicht. Seine besonderen Fähigkeiten liegen im sehr feinen Geruchs- und Geschmackssinn und im guten Gehör. So vermag er wie die Fledermäuse vor allem auch Ultraschallgeräusche wahrzunehmen.
Die grosse Stärke liegt in seinem Stachelkleid, das selbst jeden Angriff einer Schlange abhält. Dank dem schnellen Reaktionsvermögen, es liegt unter einer Hundertstelssekunde, kann er mit dem Einrollen auch schnellsten Zugriffen wirksam begegnen.
Der Winterschlaf, eine Art Energiespartechnik
Alle Igel verschlafen den Winter ab November bis in den März hinein an einem geschützten Ort, so etwa in einer gepolsterten Erdmulde unter einem Laubhaufen. Während des Winterschlafes sinkt die Körpertemperatur von normal 34 Grad auf drei Grad hinunter und der Puls von rund 200 Schlägen auf einen Schlag pro Minute. Die lebenserhaltenden Körperfunktionen werden damit auf das Allernotwendigste reduziert. Das Erwachen aus dem Winterschlaf stellt an den Igel die grössten Anforderungen in seinem Leben. Damit die Körpertemperatur wieder um 30 Grad steigt, muss der Puls vorübergehend auf etwa 320 Schläge pro Minute erhöht werden. So sind denn die Tiere nach dem Winterschlaf meist völlig erschöpft und machen oft den Ein- druck, als würden sie sterben. Wachen sie aus irgendwelchen Gründen mehrmals auf während eines Winters, so sterben sie auch tatsächlich an Erschöpfung.
Kranke und untergewichtige Igel haben im Winter unsere Hilfe nötig
Es sei vorweggenommen: Der Igel ist kein Haustier. Er gehört in die Natur und benötigt uns nur, wenn er krank oder weniger als 700 Gramm schwer ist. Wenn wir im Dezember auf einen herumstreunenden Igel stossen, sollte man ihn zuerst etwas beobachten. Kann er sich nicht mehr ganz zusammenrollen, ist er sehr wahrscheinlich krank. Weitere Krankheitsanzeichen sind: Futterverweigerung, starker Durchfall, Husten, Röcheln, trockene Nase, unsicherer Gang, seitliches Umfallen, Geschwulste und Abszesse. Ein kranker Igel gehört in jedem Fall in die Hände von fachkundigen Personen.
Neben kranken Igeln trifft man im Winter aber auch ab und zu einen jungen, untergewichtigen Igel der Herbstgeneration auf der Futtersuche. Solche Tiere füttert man massvoll mit Nüssen, möglichst ungezuckerten «Totenbeinchen», Mehlwürmern und Whiskas-Katzenfleisch. Ferner gibt man ihnen Wasser zu trinken. Milch verursacht mit Sicherheit Durchfall! Als Futtergeschirr verwendet man einen Porzellanteller. Beim Benagen von Plastikgefässen können sich die Igel nämlich vergiften.
Als Wohnplatz eignet sich eine grosse Kiste, die man mit Heu, Laub, Stroh und Zeitungen auskleidet. Harasse sind Todesfallen, weil die Igel mit dem Kopf zwischen den Holzstäben stecken bleiben können und dann ersticken. Auch Wolltücher und Stofflappen sind ungeeignet, weil sich diese Materialien gern um die Zehen wickeln, was zu Geschwüren führen kann. Man bringt den aufgenommenen Igel ferner so bald wie möglich in ein lauwarmes Wasserbad, duscht ihn nachher und trocknet ihn dann ab. So verliert er die Flöhe, und die Zecken lockern sich. Letztere dreht man ohne Öl mit einer Pinzette langsam aus der Haut.
Wenn der Igel ein Gewicht von 700 Gramm erreicht hat, sollte man ihn an einem warmen Wintertag wieder in seinem angestammten Revier, also dort wo man ihn gefunden hat, aussetzen. Igel sind ortstreu und leben in der Regel in einem Gebiet von etwa 500 m Umkreis. Geht das nicht, so kann man ihn auch zu Hause überwintern, indem man ihn samt Kiste in einen Kellerraum bringt, dessen Temperatur unter 10 Grad liegt. Dort gibt man ihm noch so lange zu essen und zu trinken, bis er in den Winterschlaf verfällt. Nachher sind nur noch gelegentliche Kontrollen nötig. Wenn er dann im Frühling wieder erwacht, lässt man ihn an einem warmen Tag frei.
Kinderstube der Igel

Die Igelmutter wirft nach einer Tragzeit von 5–6 Wochen im Mai/Juni und vielleicht noch einmal ausgangs Sommer 5–7 Junge. Sie sind 5–9 cm lang, wiegen 12–25 g und sind noch blind und taub. Sie tasten sich aber trotzdem immer wieder geschickt an die Zitzen, um zu trinken.

Während der Geburt liegen die Erstlingsstacheln wie versunken im Hautpolster. Bald ragen sie 6 mm aus der grauen Haut, und dann erscheinen die dunkel-hell geringelten Stacheln der zweiten Generation.

In der dritten Woche öffnen sich Ohren und Augen. Die Jungigel sind jetzt auch voll behaart und bestachelt, und die Mutter kann sie auf die ersten gemeinsamen Beutezüge mitnehmen.
Igel verschlafen 18 Stunden eines Tages in ihrem Nest

Igel sind ortstreu und bleiben oft jahrelang in ihren einige Hektaren grossen Jagdrevieren, wenn diese nicht verarmen, und wenn sie darin nicht gestört werden. Die Wachzeiten richten sich wahrscheinlich vor allem nach einer inneren Uhr und liegen zwischen 18–21, 24–2 und 5–6 Uhr.
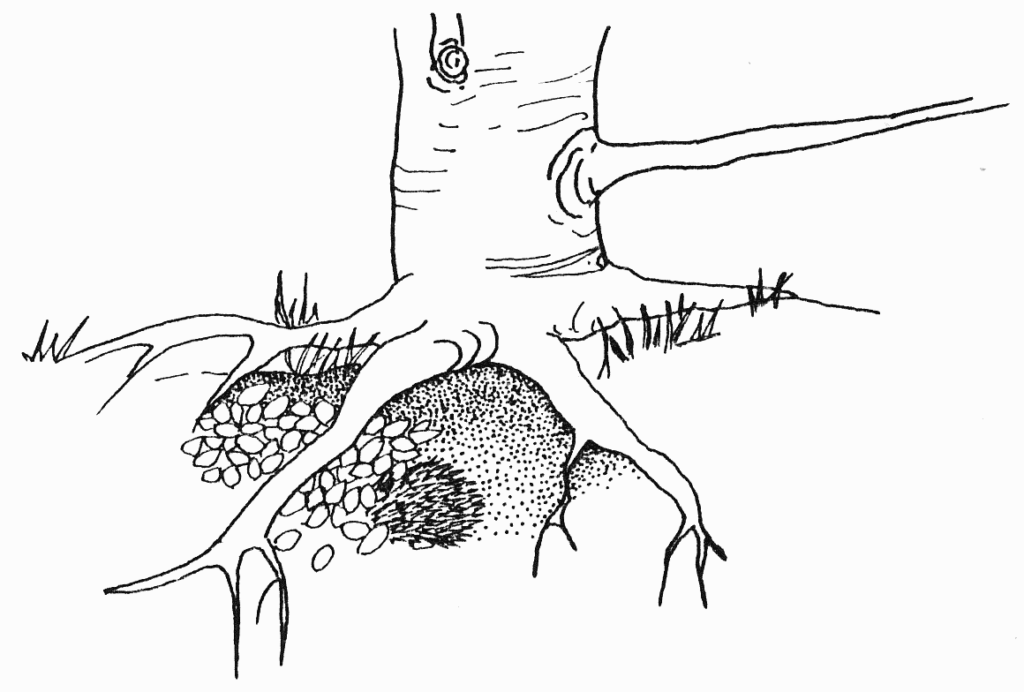
Der Igel baut sein Sommernest aus Heu und Laub im Wurzelwerk eines Baumes, in Löchern, Hecken oder in Holz- und Reisighaufen. Es hat meistens mehrere Eingänge.
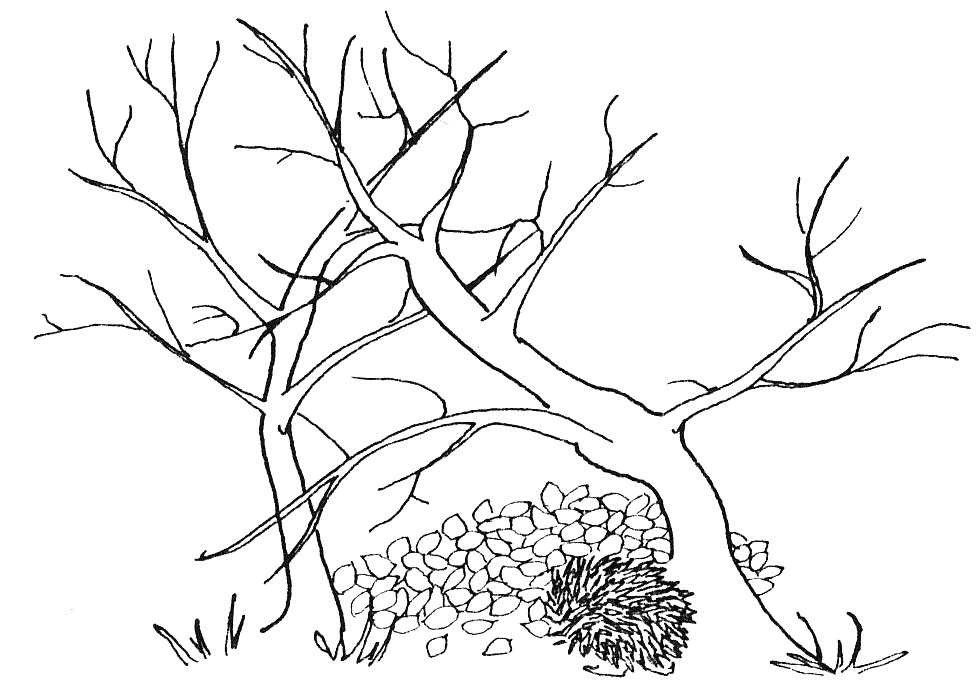
Für die Überwinterung verwendet er nicht selten das vorher dick ausgepolsterte und sorgfältig abgedichtete Sommernest. Sobald die Temperatur im Nest unter 17° sinkt, kugelt er sich ein und verfällt in den Winterschlaf.
Der Igel gehört zu den Insektenfressern

Er besitzt eine spitze, langgezogene Schnauze und im ganzen 36 lückenlos aneinandergereihte, scharfe Zähne. Seine Speisetafel enthält:
- Insekten und deren Larven (vor allem Heuschrecken und Maulwurfsgrillen, aber auch Hummeln, Wespen und Honigbienen)
- Regenwürmer, Nacktschnecken
- seltener Amphibien, Reptilien und junge Mäuse
- Pilze, Eicheln, Buchnüsse, Beeren
- Fallobst als Notnahrung.
Stachelkleid und kurze Reaktionszeiten schützen den Igel

Spuren mit Trittsiegeln
Die Trittsiegel der Hinterfüsse liegen in denjenigen der Vorderfüsse. Die Vorderfüsse sind aber länger und breiter als die Hinterfüsse, darum decken sich die Trittsiegel nicht ganz.
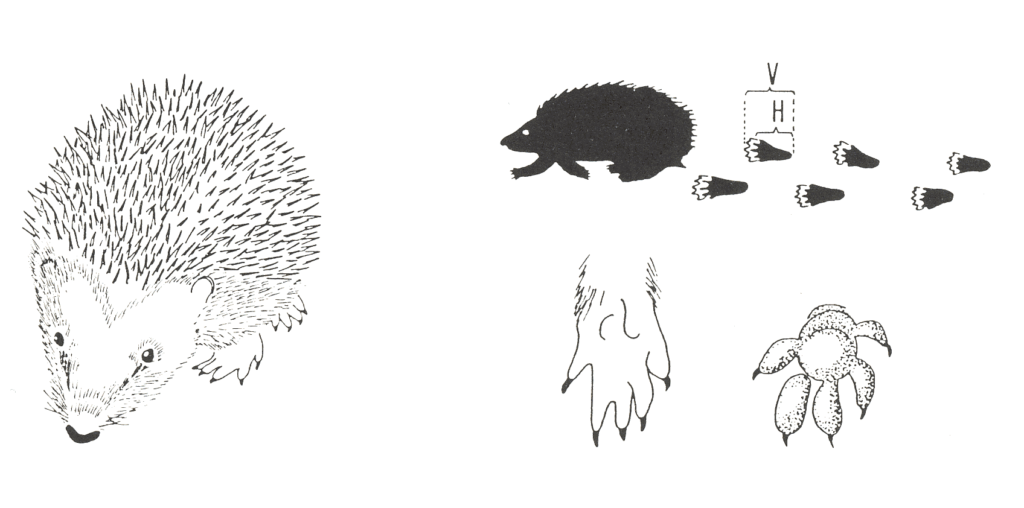
Zum Vergleich: Spuren und Trittsiegel von Hund und Katze
Über den Winterschlaf der Warmblüter
Verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf Temperaturänderungen
Zu den Warmblütern rechnen wir alle jene Tiere, die sich durch stets mehr oder weniger gleich hohe Eigentemperaturen auszeichnen, also die Säugetiere und die Vögel. Im Gegensatz dazu passen die wechselwarmen Tiere ihre Körpertemperatur in gewissen Grenzen den jeweiligen Aussentemperaturen an. Zu diesen Tieren gehören alle Wirbellosen und von den Wirbeltieren die Fische, Amphibien und Reptilien.
Eine Reihe von Säugetieren, denen während der kalten Jahreszeit nicht mehr genügend Nahrung zur Verfügung steht, hat die erstaunliche Fähigkeit entwickelt, alle lebenswichtigen Vorgänge im Körper auf Sparschaltung zu stellen und in einen tiefen Schlaf zu fallen. Das wichtigste Merkmal ist das Absinken der Körpertemperatur auf meist wenige Grade über dem Nullpunkt. Das wärmeregulierende Zentrum im Gehirn wird dazu vorübergehend ausgeschaltet.
Zu den Winterschläfern gehören vor allem stammesgeschichtlich ältere Säugetiere wie der Igel, die Fledermäuse, das Murmeltier, der Siebenschläfer, die Haselmaus und andere mehr. Man zählt sie zu den niederen Warmblütern, währenddem beispielsweise fast alle Raubtiere zu den höheren Warmblütern gehören und keinen Winterschlaf kennen.
Alle Warmblüter verhalten sich bei sinkenden Temperaturen zunächst gleich. Sie atmen schneller, verbrauchen mehr Nährstoffe und bewegen sich kräftiger und schneller. In unseren modernen Häusern arbeiten die Ölbrenner bei Kälteeinbrüchen in ähnlicher Weise, ebenso automatisch wie die Warmblüter. Nicht alle Säugetiere sind in der Lage, der Abkühlung über längere Zeit zu trotzen und andauernd aufzuheizen. So erstarren zum Beispiel viele anfänglich noch quicklebendige Mäuse, Spitzmäuse und Maulwürfe schon nach wenigen kalten Nachtstunden in ihren Fallen, weil sie ohne neue Nährstoffe nicht mehr fähig sind, ihre Körpertemperatur zu halten. Der Kältetod tritt ein, denn schon bei einer Körpertemperatur von 20° wird das Atemzentrum gelähmt. Diese Tatsache müssen auch die Ärzte berücksichtigen, wenn sie vor einer schwierigen Operation den menschlichen Körper so stark abkühlen, dass sich alle Lebensfunktionen verlangsamen. Das Atemzentrum, ein wichtiger Teil des Gehirns, muss, wenn auch stark reduziert, weiterarbeiten.
Umschaltung der Wärmeregulation
Der Winterschläfer kann seine Wärmeregulation umschalten und damit die Körpertemperatur auf fast null Grad absinken lassen. Er passt sie der Umgebungstemperatur an, verfällt in tiefen Schlaf und kann so enorm Nährstoffe sparen. Allerdings darf sich auch sein Körper nicht unter den Gefrierpunkt abkühlen. Dies würde auch bei ihm unweigerlich zum Tode führen. Beim Erreichen der Minimaltemperatur, die im allgemeinen zwischen null und fünf Grad liegt, wird die Wärmeregulation wieder automatisch eingeschaltet; das noch schlafende Tier setzt seine «Heizung» wieder auf eine höhere Stufe und erwacht allmählich. Die Heizungstechniker haben diese Einrichtung kopiert: Ein Thermostat in der Wohnung reagiert auf das Absinken der Zimmertemperatur unter beispielsweise 20 Grad und bewirkt das Einschalten des Ölbrenners.
Für die Igel gelten folgende kritische Körpertemperaturen: Unter 14.5 Grad tritt fester Winterschlaf ein und bei 1 Grad über dem Nullpunkt erwachen sie wieder, damit sie nicht erfrieren. Bei den Fledermäusen liegen die kritischen Temperaturen bei 10 beziehungsweise 2 Grad.
Der Winterschlaf wird vorbereitet
Schon lange vor dem Winterkälteeinbruch treffen die meisten Winterschläfer Vorbereitungen für ein sicheres Überstehen der kalten Jahreszeit. Sie zeigen damit die innere Bereitschaft für den Winterschlaf. Das Murmeltier wandert aus den höheren Gebirgslagen an tiefer gelegene Stellen, wo es seinen Winter-bau hat. Dieser besteht aus einer langen Röhre, die schräg nach unten in einen geräumigen, mit Heu ausgepolsterten Kessel führt. Darin legen sich meistens ganze Familien mit zehn und mehr Mitgliedern für den langen Schlaf zurecht, nachdem sie die Zugangsröhre sorgfältig mit steiniger Erde verrammelt haben.
Der Igel macht hingegen keine grossen Umstände. Sein Winternest gleicht einem Sommernest und liegt oberflächlich in einem Laub- oder Komposthaufen oder im Schutze einer dicht verwachsenen Hecke. Er polstert seine Schlafstätte nur wenig. Ab und zu finden sich an der gleichen Stelle auch mehrere Igel ein, die aber nicht so eng beieinander liegen wie die Murmeltiere.
Die Fledermäuse begnügen sich mit Ritzen und Spalten einer Höhle, aber auch ältere Bauten mit ruhigen Kellern, Türmen oder einem vernachlässigten Estrich sind gut genug. Hier hangen sie dann Winter für Winter an den gleichen Stellen, indem sie sich mit den Krallen der Hinterfüsse festhaken.
Siebenschläfer und Haselmäuse überwintern in Baumhöhlen, lockerem Mauer-werk oder unter grossen Steinen. Der Siebenschläfer ist auch in der Lage, sich tief in den Boden einzugraben und sich so vor allzu grosser Kälte zu schützen, währenddem die Haselmaus dieser Gefahr mit dem Anlegen eines äusserst sorgfältig abgedichteten Winternestes zu begegnen sucht. Beide rollen sich kugelartig ein, pressen die Vorderpfoten ans Gesicht und legen den Schwanz dazwischen über den Kopf.
Die Lebensvorgänge während des Winterschlafes
Wir wissen, dass sich die Lebensvorgänge in dem Masse vermindern, wie die Körpertemperatur sinkt. Eine Temperaturabnahme um 10 Grad bewirkt eine Reduktion auf die Hälfte, eine solche um 20 Grad eine solche auf einen Viertel usw. Im Winterschlaf brennt das Leben auf kleinster Sparflamme. Der Igel macht pro Minute noch einen Atemzug (im Wachzustand: 50 pro Minute, im Tagesschlaf noch 20 pro Minute). Die Tätigkeit des Grosshirns erlischt und die grossen Nervenstränge werden abgeschaltet. Die Augen sind verschlossen, und auch das Gehör nimmt keine Geräusche mehr wahr. Nur ein Reiz weckt den Winterschläfer: Die kritische Kältestufe von etwa 4 Grad wird registriert und ins Gehirn weitergeleitet.
Zur Erhaltung des kleinen Lebensfunkens reichen die im Körper aufgespeicherten Fettvorräte aus. Das Reservefett wird während der warmen Jahreszeit unter der Haut in einer sehr dicken Schicht abgelagert, ausserdem zwischen den Eingeweiden.
Die meisten Winterschläfer kennen keinen durchgehenden Schlaf. So unterbricht ihn das Murmeltier etwa alle drei bis vier Wochen, in den gut fünf Monaten also sechsmal. An jedem dieser sechs Wachtage verliert es ungefähr ebensoviel Gewicht wie in den Tagen einer vierwöchigen Schlafperiode zusammen. Das Aufheizen des Körpers und das Erwachen brauchen eben sehr viel Energie. Der Hamster hat nur sehr kurze Schlafzeiten. Er wacht alle fünf Tage auf und benötigt darum viele Reservestoffe. Er legt vor der Winterschlafperiode recht zahlreiche Vorräte an, denn seine Fettreserven würden allein den Bedarf nie decken. Auch der Igel erwacht bisweilen für einige Stunden und sucht vielleicht nach Nahrung, weil seine Fettvorräte nicht ausreichen, wenn er mehrmals aufheizen muss. Wenn wir im Winter einen umherstreunenden Igel finden, müssen wir ihn füttern, wenn er die nächste Schlafperiode überstehen soll.
| Zustand des Murmeltieres | Temperatur | Atemfrequenz | Herzfrequenz |
|---|---|---|---|
| wach | 34–39° | 25–30 Züge/min | 80 Schläge/min |
| im Winterschlaf | um 3° | 1 Zug/5 min | 4–5 Schläge/min |
| aus dem Winterschlaf erwachend | steigt bis auf 37° | steigt bis auf 67 Züge/min | steigt bis über 200 Schläge/min |
Verlauf der Körpertemperatur bei verschiedenen Tiergruppen, wenn die Umgebungstemperatur abnimmt
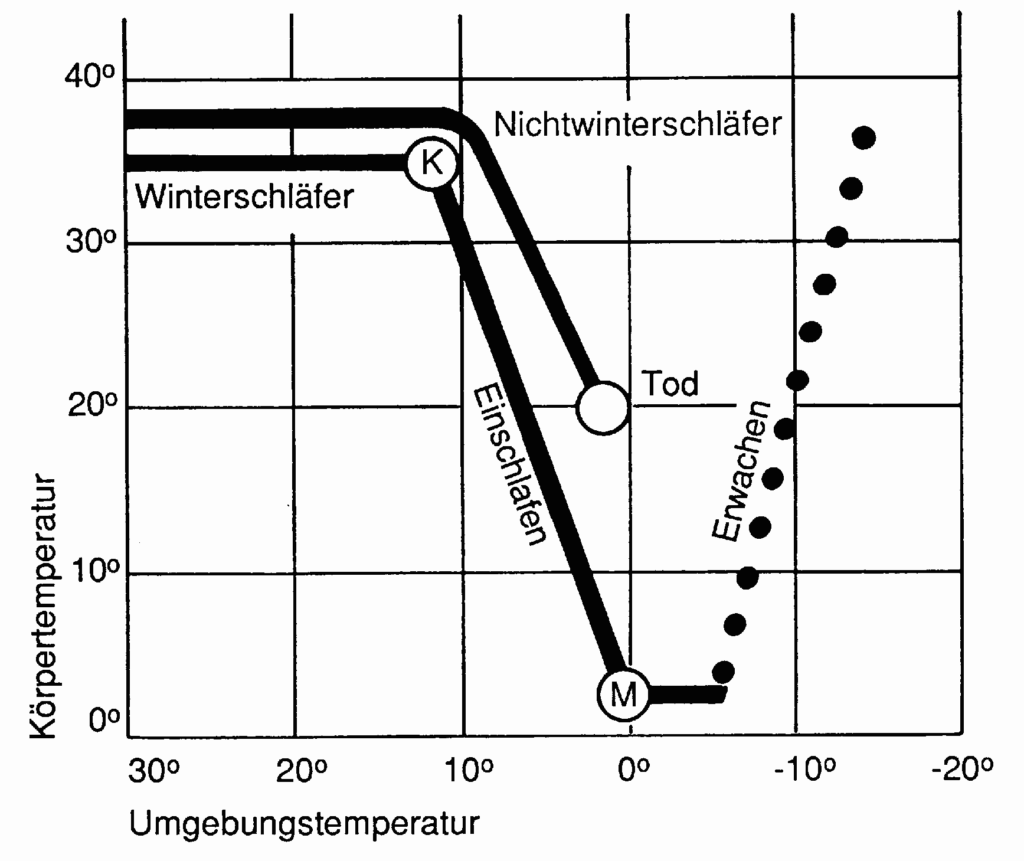
Sinkt die Umgebungstemperatur, so sinkt auch die Körpertemperatur der wechselwarmen Tiere. Die Warmblüter aber heizen ihren Körper auf:
- Vögel halten ihre Körpertemperatur auf etwa 42°.
- Säuger ohne Winterschlaf halten ihre Körpertemperatur auf etwa 37°. Einzelne können bei tiefen Umgebungstemperaturen in Schwierigkeiten geraten und erleiden dann unter Umständen den Kältetod.
- Winterschläfer schalten bei einer Aussentemperatur von unter 20° ihre Wärmeregulation um, fallen in einen tiefen Schlaf und sparen so Nährstoffe. Sinkt ihre Körpertemperatur unter 4°, erwachen sie automatisch.
Waldkauz




Grundbesitz ohne Gartenzaun
Viele von uns kennen den Waldkauz wenigstens von einer Seite her: Der «Gesang» des Männchens, das dreisilbige «Huuh-hu-huuuuuh», kann einem durch Mark und Bein gehen, wenn man in Spätwinter- oder Frühlingsnächten längs eines Waldrandes spaziert. Fast könnte man meinen, der irgendwo im Gehölz versteckte Vogel wolle einem das Gruseln beibringen. Davon kann aber keine Rede sein. Mit seinen unheimlichen Rufen will er nichts anderes sagen als: «Hier bin ich, dieses Revier gehört mir.» Wir Menschen brauchen für die Abgrenzung unseres Eigentums Wohnungstüren, Gartenzäune und Marchsteine, für den Waldkauz liegen die Grenzen seines Jagd- und Wohnraumes ungefähr dort, wo ihn die andern Waldkäuze noch gut hören können. Die übrigen Vögel müssen diese Reviere nicht beachten, denn ihre Lebensbedürfnisse entsprechen kaum denjenigen des Kauzes.
Auf der Suche nach einem Nest
Nach geduldigem Suchen und Ausharren in kalten, hellen Winternächten hat man vielleicht einmal das Glück, einen solchen Revierbesitzer ausfindig zu machen. Viel mehr als lautlos vorübergleitende Schatten wird man allerdings kaum zu Gesicht bekommen, doch findet man so möglicherweise den ungefähren Standort des Nestes.
Vor Jahren hatte ich einmal Glück und entdeckte eine Baumhöhle in fünf Metern Höhe. Der dicke Buchenstamm war unten vollkommen astlos, und das Nest konnte nur mit einer hohen Leiter erreicht werden. Ich erinnere mich noch gut an jene frühen Aprilmorgenstunden, als ich, mit breitem Filzhut und dicken Handschuhen ausgerüstet, langsam Sprosse um Sprosse hinaufstieg. Ich wusste, dass die alten Waldkäuze angreifen würden, wenn sie mich in Nestnähe entdecken sollten. Ausgewachsene Tiere sind immerhin etwa 40 cm hoch, haben eine Flügelspannweite von knapp einem Meter und können im Sturzflug sehr wuchtig und erst noch fast lautlos angreifen. Einer meiner Freunde erlebte das vor geraumer Zeit auf halber Leiterhöhe. Aber trotzdem, das Jagdfieber hatte mich gepackt, und ich wollte in die Nesthöhle hineinsehen.
Vor mir ducken sich zwei stattliche Jungvögel und blicken mir mit fast zugekniffenen Augen ängstlich entgegen. Sie haben ihre ersten, weisslichen Dunenfedern schon längst verloren und tragen jetzt ein hellgraues Kleid mit dunkelbraunen Querwellen. Schnabel und Fänge sind schon kräftig entwickelt, die Flügel gestatten hingegen noch keine Flugversuche. Auf dem Boden der Baumhöhle liegt schwarzglänzender Kot. Gewöllekugeln entdecke ich keine. Waldkäuze haben nämlich wie andere Raubvögel die Gewohnheit, unverdauliche Nahrungsreste (Haare, Federn, Knochen Insektenpanzer ihrer Beutetiere) wieder hinauszuwürgen. Wahrscheinlich sind diese Überreste von den Eltern weggetragen oder von den Jungvögeln auf den Boden geworfen worden. Die beiden Käuzchen zwängen sich immer mehr ins Innere der Baumhöhle zurück und kappen bedenklich mit den Schnäbeln. Ob wohl dieses Geräusch die Eltern herbeilockt? Diesen weiche ich lieber aus, und so steige ich wieder auf den Boden hinunter.
Bald verlassen die Jungen ihren Brutplatz und erreichen mit einem unsicheren Flug den Boden. Die Eltern locken sie in ein schützendes Unterholz und füttern sie weiter, bis sie die volle Flugfähigkeit erreicht haben. Mit Standlauten und Bettelrufen bleiben die Kinder mit ihren Eltern in Verbindung. Wenn sich ihnen ein Mensch nähert, machen sie sich zuerst schlank, nehmen dann aber meist eine Drohstellung ein.
Balz und Brutzeit
Schon nach einem Jahr sind die Waldkäuze geschlechtsreif, und im folgenden Winter werben die Männchen mit heulenden und stöhnenden Balzrufen um eine Partnerin. Sie wählen auch die Brutplätze aus – neben Baumhöhlen kommen Felsspalten, Gemäuernischen, Hohlräume unter Baumwurzeln oder gar Dachböden in Frage – und zeigen diese ihren Weibchen gewöhnlich durch Rufen an der gewählten Stelle oder durch Anfliegen. Waldkäuze vermählen sich in der Regel auf Lebzeit. Im Februar legt das Weibchen drei bis fünf, etwa 40 Gramm schwere, reinweisse, rundliche Eier, und zwar in zweitägigen Abständen. Es leistet die ganze Brutarbeit alleine. Nach knapp 30 Tagen schlüpft das erste, weissbedunte, blinde Käuzchen, die Geschwister kommen je zwei Tage später auf die Welt. Die Mutter deckt dann ihren Nachwuchs noch zwei Wochen lang mit den Flügeln zu. Man nennt diese Tätigkeit hudern.
Während dieser Zeit leistet aber auch das Männchen Beachtliches. Es hat für die gesamte Nahrung seiner stets grösser und gefrässiger werdenden Familie zu sorgen. Meistens jagt es nur in der Dämmerung oder in der Nacht. Zu den hauptsächlichsten Beutetieren gehören Mäuse, Ratten und andere Kleinsäuger dieser Grösse, Vögel, aber auch Frösche, grössere Insekten und Regenwürmer.
Körperbau und Sinnesorgane
Die Waldkäuze bringen für die Jagd beste Voraussetzungen mit. Einmal haben sie besonders gebaute Flügel mit Fransenkämmen an den äussersten Schwungfedern, welche die Fluggeräusche verschlucken und einen nahezu lautlosen Flug gewährleisten. Dann ist ihr Gehör hervorragend entwickelt. Die Ränder der Ohröffnungen sind zu befiederten Klappen umgebildet, die wie weite, bewegliche Schalltrichter wirken und schwächste Geräusche aus verschiedenen Richtungen auffangen. Und schliesslich sind die Augen nicht nur für allfällige Tätigkeiten am Tag, sondern auch für ein gutes Dämmerungssehen eingerichtet. Die Zahl der lichtempfindlicheren Stäbchen ist auf Kosten der Zäpfchen stark vermehrt. Darum können die Waldkäuze Farben fast nicht unterscheiden, was nachts auch nicht störend ins Gewicht fällt. Sie sind zudem weitsichtig wie alle andern Eulen, sehen also auf kurze Distanzen schlecht. Für einen Jagdvogel spielt aber auch das keine Rolle. Er muss die Beute auf grosse Distanzen erkennen, und das gewährleisten die dafür bestens ausgerüsteten Augen und das fabelhafte Gehör, zusammen mit dem sehr beweglichen Kopf, den er bis 270 Grad herumdrehen kann.
Steckbrief des Waldkauzes
| Männchen | Weibchen | |
|---|---|---|
| Körperhöhe | etwa 40 cm | etwa 42 cm |
| Spannweite | im Durchschnitt 93 cm | im Durchschnitt 98 cm |
| Gewicht | 300–550 g | 500–700 g |
| Färbung | bei beiden Geschlechtern von braungrau bis rostbraun, grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Vögeln | |
| Stimme | Balzstrophe: tiefes, wohlklingendes hu-u, nach kurzer Zeit folgt tremolierendes, absinkendes u-u-u-u-u | gellendes Kiuwitt, wird auch vom Männchen verwendet |
Lebensraum, Jagd, Ernährung
- bewohnt alte Baumbestände in lichten Laub- und Mischwäldern, Feldgehölzen und Baumgärten; lebt selbst in Dörfern und Städten
- ist die häufigste Eulenart und gehört zu den Standvögeln
- jagt mit Vorliebe in abwechslungsreichen Landschaften, und zwar entweder vom Ansitz aus oder im Pirschflug
- ernährt sich zu 75% von Kleinsäugern (vor allem von Mäusen), daneben von Amphibien, Fischen, Regenwürmern, Insekten usw., in strengen Wintern auch von Vögeln
Fortpflanzung
- brütet in alten, hohlen Bäumen, in Höhlen, auch in Gebäuden oder offen auf Greifvogelnestern; baut selber keine Nester
- Eiablage: Februar/März; meist 3–4 Eier; Brutdauer: 28–29 Tage
- Weibchen brütet alleine; Männchen bringt Nahrung
- Nestlingszeit: etwa 30 Tage; Junge werden aber am Boden von den Eltern noch 8–10 Wochen weiter gefüttert, betreut und verteidigt
Käuze teilen ihren Wohnraum mit vielen anderen Tieren
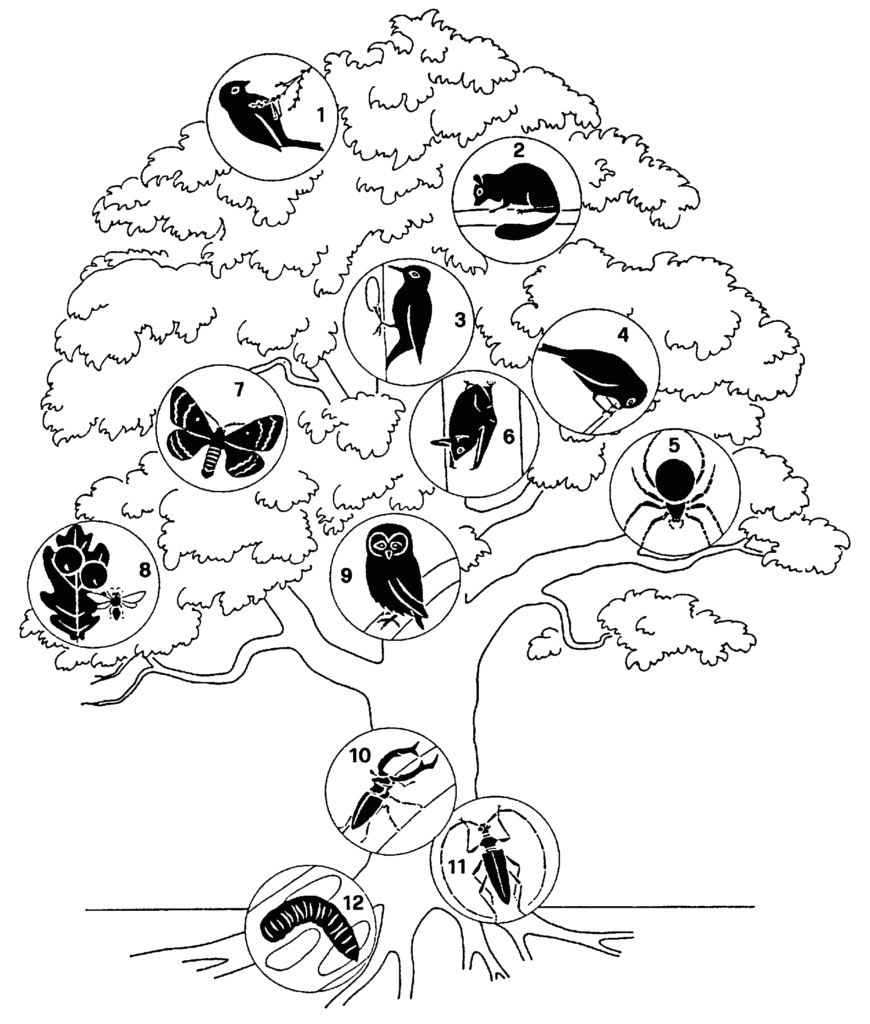
- Blaumeise
- Siebenschläfer
- Buntspecht
- Kohlmeise
- Kreuzspinne
- Langohrfledermaus
- Eichenspinner
- Eichengallwespe
- Waldkauz
- Hirschkäfer
- Heldbock
- Larve des Heldbocks
Zum Brutverhalten des Waldkauzes
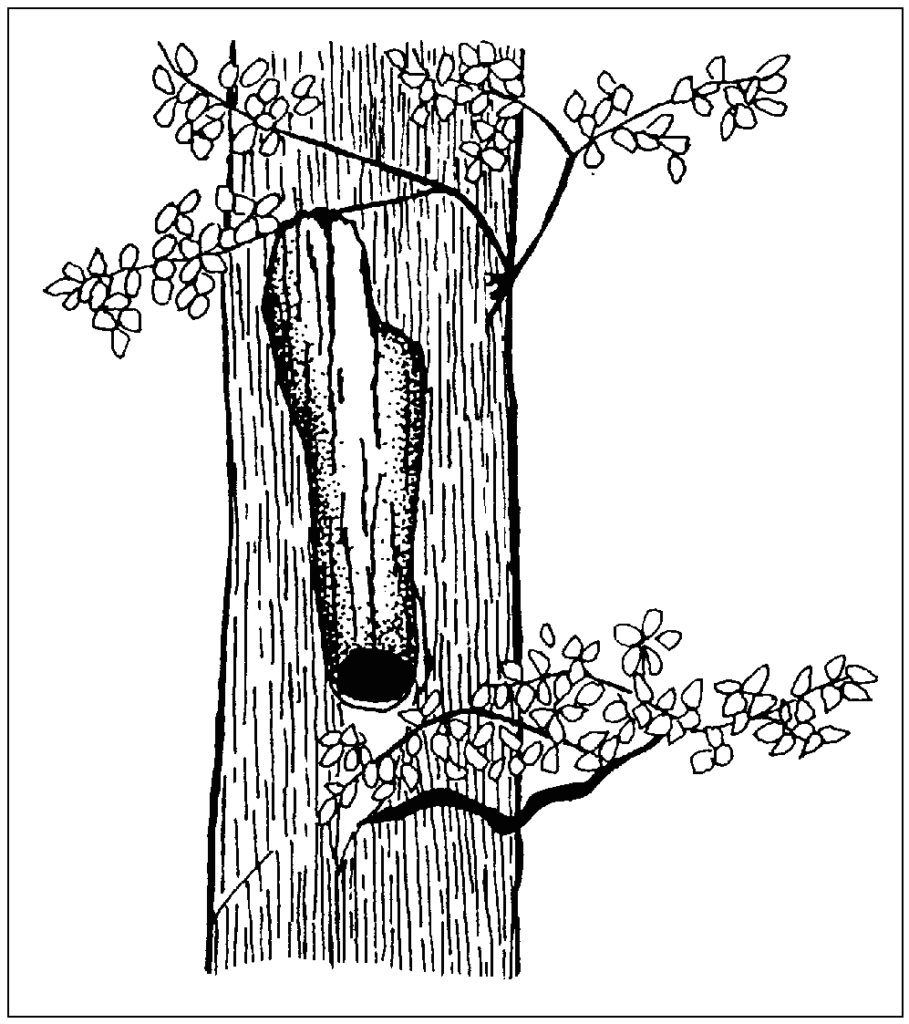
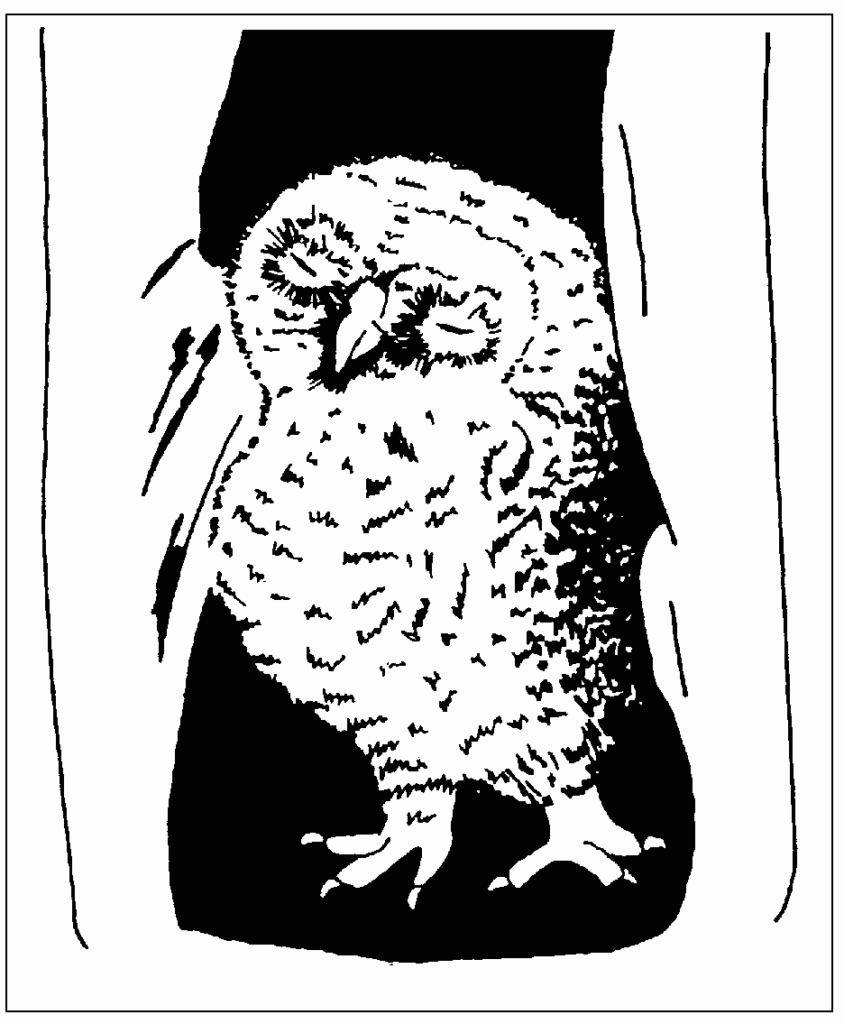
Brutplätze
Waldkäuze bauen wie die meisten anderen Eulen ihre Nester nicht selber. Als Brutplätze dienen vor allem Baumhöhlen, aber auch Felsspalten, Nischen in Dachböden und Gemäuern, verlassene Nester grosser Vögel, sogar Hohlräume unter Baumwurzeln oder selbstgegrabene Mulden auf der Bodenoberfläche.
Aufzucht der Jungen
Im Februar legt das Weibchen 3–5 etwa 40 g schwere, reinweisse Eier, und zwar in zweitägigen Abständen. Nach knapp 30 Tagen schlüpft das erste, weissbedunte, blinde Käuzchen, die Geschwister kommen je 2 Tage später auf die Welt. Zwei Wochen lang deckt die Mutter ihren Nachwuchs mit den Flügeln. Man nennt das hudern. Das Männchen sorgt während der ganzen Zeit allein für die gesamte Nahrung der immer gefrässiger werdenden Familie.
Der Waldkauz ist ein Raubvogel
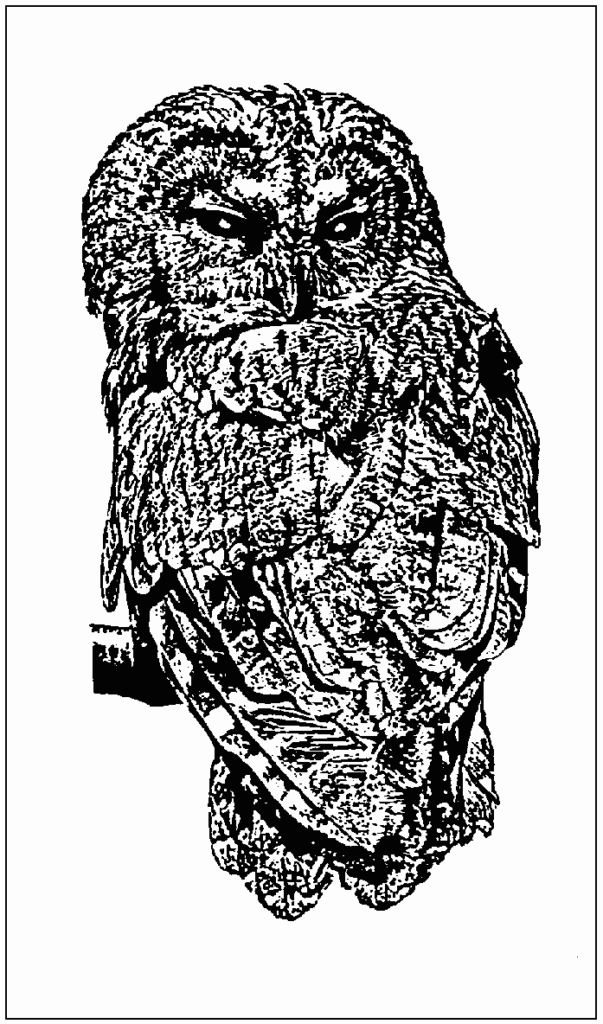

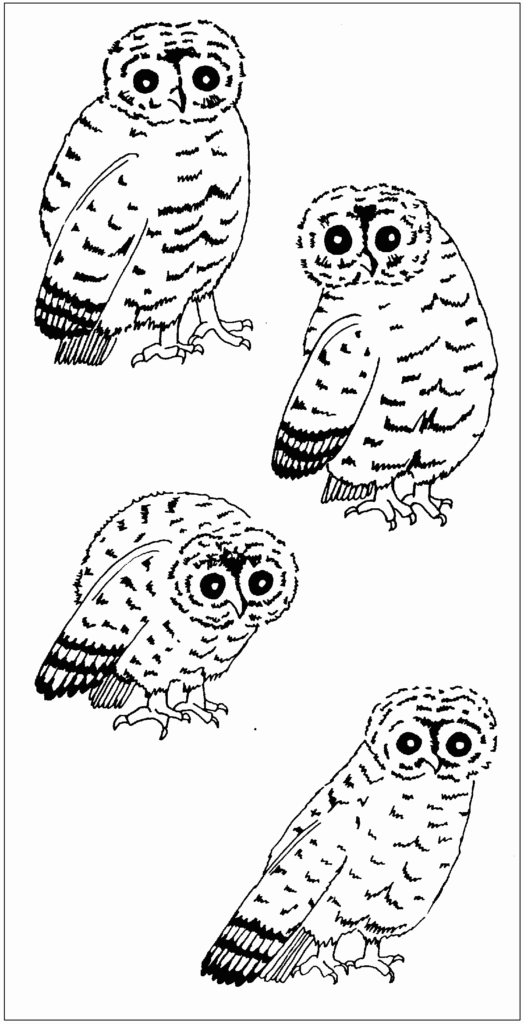
Er jagt in der Dämmerung oder nachts sowohl vom Ansitz aus als auch im Pirschflug. Seine Nahrung besteht aus bis rattengrossen Kleinsäugern und bis taubengrossen Vögeln. Daneben erbeutet er Amphibien und Eidechsen, selten Fische, ab und zu auch Regenwürmer und grosse Insekten. Als geschickter Vogeljäger überlebt er im Unterschied zu anderen Eulenarten, die hauptsächlich auf Mäuse angewiesen sind, selbst strenge Winter.
Der Waldkauz sieht auch am Tag, seine Augen sind aber der nächtlichen Lebensweise angepasst: Die Netzhaut enthält fast nur Stäbchen, also besonders lichtempfindliche Sinneszellen. Dafür fehlen die Zäpfchen weitgehend, die dem Farbensehen dienen. Diese spielen im fahlen Mondlicht auch keine Rolle. Es ist viel wichtiger, neben der Beute auch die Bäume sicher erkennen zu können. Im Stockdunkeln sehen allerdings auch Eulen nichts.
Der starre Blick des Waldkauzes
Der Waldkauz hat starr mit dem Schädel verwachsene Augen. Er kann sie also nicht bewegen wie wir. Um ein Ding genau zu betrachten, verrenkt er seinen Körper merkwürdig. Er führt die sogenannten Fixierbewegungen oft über 20mal nacheinander aus. Daneben kann er seinen Kopf auch noch um 270° drehen.
Wenn der Waldkauz etwas fixieren will, verschiebt er den Kopf zuerst seitwärts und gleich darauf nach unten. Dann dreht er ihn in einem Bogen nach rechts oben und wieder zurück in die Seitwärtsstellung.
Verwandte des Waldkauzes
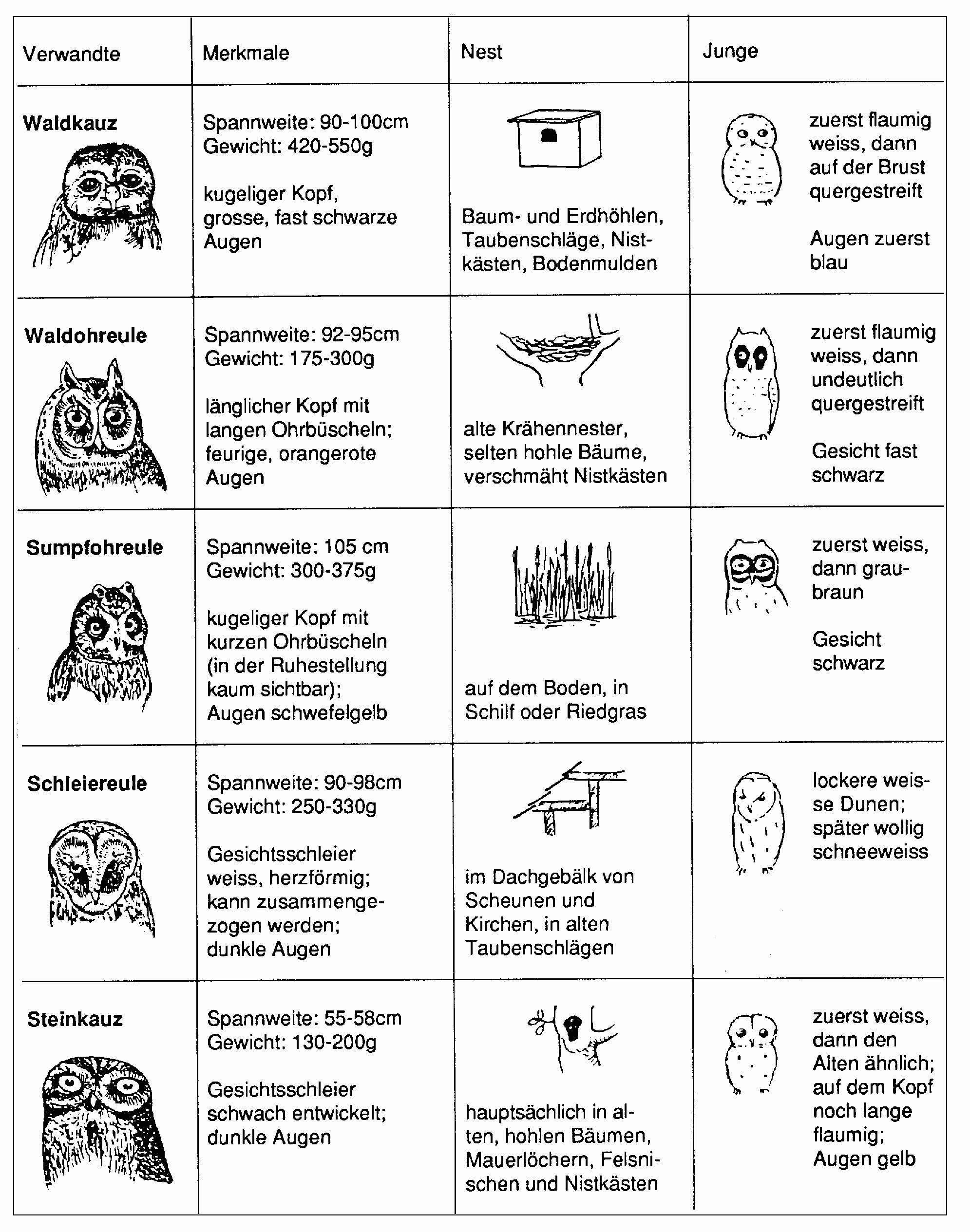
Weitere Informationen
- Der Waldkauz | Strix aluco – Eine schön gemachte, private Website über den Waldkauz
Reptilien






























Blindschleichen
Tiere, die auch nur entfernt schlangenähnlich aussehen und sich wie diese fortbewegen, haben seit jeher vielen Menschen Furcht eingejagt. Noch heute greifen darum einige von ihnen nach Steinen oder einem Stock, um die praktisch wehrlosen Tiere, seien es Schlangen oder Blindschleichen, totzuschlagen. Solches Tun ist verwerflich und zeugt von einer grossen Verständnislosigkeit.
Zum Namen
Blindschleichen sind farbenblind und können zudem verschiedene Graustufen nur schlecht voneinander unterscheiden, aber blind sind sie keineswegs. Schlafende und auch tote Blindschleichen haben mit zwei Lidern verschlossene Augen. Es ist denkbar, dass man darum auf den Gedanken kommen könnte, sie seien blind.
Der deutsche Name lässt sich vom althochdeutschen Wort «Plintslicho» herleiten, was soviel wie «blendender Schleicher» bedeutet. Die Bezeichnung nimmt Bezug auf die kupfer- und bleiglänzenden Färbungen der Körperoberseite und Körperunterseite. Plinte oder Blende sind Ausdrücke für metallische Minerale.
Zur Verwandtschaft
Der schlangenähnliche, langgestreckte und vollkommen beinlose Körper ist wahrscheinlich der Grund, warum die Blindschleiche gelegentlich als Schlangenart angesehen wird. Äusserlich unterscheiden sie sich etwa von einer Ringelnatter oder Kreuzotter durch die verschliessbaren Augen, durch die Möglichkeit, den Schwanz abzuwerfen und durch die gleichartigen Schuppen rund um den Körper. Ferner müssen sie zum Züngeln den Mund öffnen; sie können also die Zunge nicht durch eine Oberlippenaussparung hin und her gleiten lassen wie die Schlangen. Das Skelett weist noch winzig kleine Schulter- und Beckengürtelreste auf, die man aber von aussen nicht sieht und auch am frei präparierten Skelett sorgfältig suchen muss. Auf Grund all dieser und noch anderer Merkmale zählt man die Blindschleichen zu den Echsen. Sehen wir uns dazu folgende Verwandtschaftsverhältnisse an:
Unter den Skinken gibt es Tiere, die den Blindschleichen recht ähnlich sehen. Als ich der Johannisechse und dem Gefleckten Walzenskink auf Cypern zum ersten Mal begegnete, glaubte ich in den schnell schlängelnden Reptilien kleine Verwandte von Blindschleichen vor mir zu haben. Diese nur etwa 10 cm langen Skinke brauchen die äusserst zierlichen Gliedmassen kaum für die Fortbewegung. Andererseits gibt es amerikanische Schleichen, die vier wohl ausgebildete Gliedmassen besitzen und mit diesen auch gehen können.
Vorkommen und Lebensraum
Wir finden die Blindschleiche fast überall in Europa, auch noch weit im Norden Skandinaviens und im Gebirge bis auf 2400 m Höhe. Sie reicht im Süden bis nach Nordafrika, und im Osten belegt sie weite Teile Westasiens. Sie ist von allen europäischen Reptilien am weitesten verbreitet, möglicherweise, weil sie an ihren Lebensraum keine allzu grossen Anforderungen stellt. Sie liebt nicht zu helle und nicht zu trockene Orte. So entdecken wir sie in Wiesen, an Wald-rändern, im lichten Wald, aber auch in Gärten und Parkanlagen. Nicht selten benützt sie Komposthaufen, ab und zu auch Ameisenhaufen als Wärmestuben. Die Ameisen können der Blindschleiche nichts anhaben, denn die Bisse durch-dringen das zähe Schuppenhemd nicht, andererseits frisst die Blindschleiche auch keine Ameisen.
Tagesrhythmus und Nahrung
Die Tätigkeiten der Blindschleiche richten sich weitgehend nach dem Tagesrhythmus ihrer Hauptnahrungstiere. Wir finden sie aktiv am frühen Morgen von 5–10 Uhr und am Abend von 18–21 Uhr, wenn der Tau auch die Regenwürmer und Nacktschnecken zum Hervorkriechen veranlasst. Tagsüber halten sie sich zwischen Moos, unter Steinen, Rindenstücken, im dichten Gestrüpp und in ihren selbstgegrabenen oder übernommenen Erdgängen auf.
Blindschleichen sind nicht in der Lage, Beutetiere zu verfolgen, was ja bei ihrer Speisetafel auch gar nicht nötig ist. Die Fortbewegung erfolgt nach Schneckenart: Über den Bauch huschen, von hinten nach vorn, rasch aufeinanderfolgend kleine Wellen, ohne dass sich die Bauchschuppen aufstellen wie bei den Schlangen. Das zusätzliche Schlängeln wirkt steif, weil alle Schuppen mit dünnen Knochenplättchen unterlegt sind, welche die Bewegungsfreiheit stark einschränken. Ohne den Widerstand auf einer rauhen Bodenoberfläche, an Pflanzen oder Steinen ist diese Bewegungsart nicht möglich.
Die zugespitzten und nach hinten eingekrümmten Zähne ermöglichen der Blindschleiche das Festhalten schlüpfriger Beutetiere. Sie packt Regenwürmer denn auch ganz langsam in der Mitte ihres Körpers und kaut sie während Minuten bis zu den Enden durch. Bei langen Würmern dauert dieses Schauspiel bis zu einer halben Stunde. Nach der Mahlzeit wischt sie sich durch seitliche Bewegungen des Kopfes den Schleim an Pflanzen ab. Wenn Nacktschnecken und Regenwürmer während ausgesprochenen Trockenzeiten Mangelware sind, verzehrt die Blindschleiche Käfer und Heuschrecken. Man kann ihnen im Terrarium darum auch ohne weiteres Mehlwürmer geben. Sie sollen auch in der Lage sein, kleine Eidechsen oder gar ihresgleichen zu verschlucken.
Fortpflanzung und Entwicklung
Im April verlassen die Blindschleichen ihre Winterquartiere, und bald nachher paaren sie sich. Das Weibchen wird vom Männchen mit den Kiefern hinter dem Kopf gepackt und festgehalten, damit es etwas vor der Körpermitte eine Schlinge um die Partnerin legen kann. So kommen die Geschlechtsöffnungen aufeinander zu liegen.
Nach einer dreimonatigen Tragzeit legen die Weibchen in der Regel 8–12 schlüpfreife Eier. Die Jungtiere zerreissen unmittelbar nach der Ablage mit ihren Körperbewegungen die gallertigen, gelblich-durchsichtigen, dünnen Eihäute. Man zählt darum die Blindschleichen wie die Bergeidechse und die Vipern zu den lebendgebärenden Reptilien. Die geschlüpften Jungen sind bereits 6 cm lang und machen sich alsbald auf die Suche nach ganz kleinen Nacktschnecken. Mit der Zeit wird ihre anfänglich silberglänzende Oberseite braun, und die dunkle, fast schwarze Bauchseite wesentlich heller. Dazu sind allerdings mehrere Häutungen nötig; während der ersten drei Jahre bis zur Geschlechtsreife sind es deren 3–4 pro Jahr. Sie schieben die alte Haut zu ringartigen Wulsten zusammen und streifen sie nachher ab. Ausgewachsen erreichen die Blindschleichen eine Länge von 40–50 cm. Sie können in Gefangenschaft bei guter Pflege über 25 Jahre alt werden.
Den Winter verbringen sie in Gängen, die bis 70 cm tief in den Boden reichen. Meistens finden wir darin mehrere Individuen beieinander, nicht selten treffen wir sogar 20 und mehr. Ab und zu gehört einer solchen Überwinterungsgesellschaft auch ein Salamander, eine Kreuzotter oder eine Schlingnatter an. Die tiefen Umgebungs- und Körpertemperaturen lassen die Tiere friedlich nebeneinander schlafen.
Feinde und Verteidigungsmöglichkeiten
Die langsamen Blindschleichen haben viele Feinde. Neben Füchsen, Mardern, Dachsen, Igeln, Schlingnattern und Kreuzottern setzen ihnen auch eine Reihe von Vögeln zu, vorab die oft auf Blindschleichen geradezu spezialisierten Mäusebussarde. Der Hauptfeind dürfte aber nach wie vor der Mensch sein, sei es, weil er blind nach allen schlangenähnlichen Tieren schlägt, oder sei es, dass er die Nacktschnecken mit Schneckentodkörnern bekämpft. Die Hälfte der Beutetiere besteht nämlich aus Nacktschnecken, und die vergiftete Nahrung bringt ihnen den Tod.
Die Verteidigungsmöglichkeiten der Blindschleiche sind bescheiden. Sie kann kleinere Angreifer beissen und mit stinkigem Kot verschmieren. Gegenüber gefährlicheren Feinden nützt oft ihr wildes, zuckendes Herumschlagen mit dem ganzen Körper oder dann das Abwerfen des Schwanzes. In der mittleren Schwanzregion sind die Wirbelkörper in der Mitte nicht verknöchert, und einer davon bricht auseinander, wenn die Blindschleiche die Schwanzmuskulatur heftig zusammenzieht. Diese Wirbel enthalten also so etwas wie vorbereitete Bruchstellen. Der abgeworfene Teil kann fast die Hälfte des Tieres ausmachen. Er zappelt noch mindestens 20 Minuten lang äusserst heftig, währenddem sich die stark verkürzte Blindschleiche möglichst schnell davonmacht und sich dem verblüfften Angreifer entzieht. Die Fleischwunde blutet kaum und verheilt sehr rasch. Der Schwanz wächst nicht nach; es bildet sich nur ein kleiner, kegelartiger Abschlussstummel.
Blindschleichen treten nicht häufig in Erscheinung
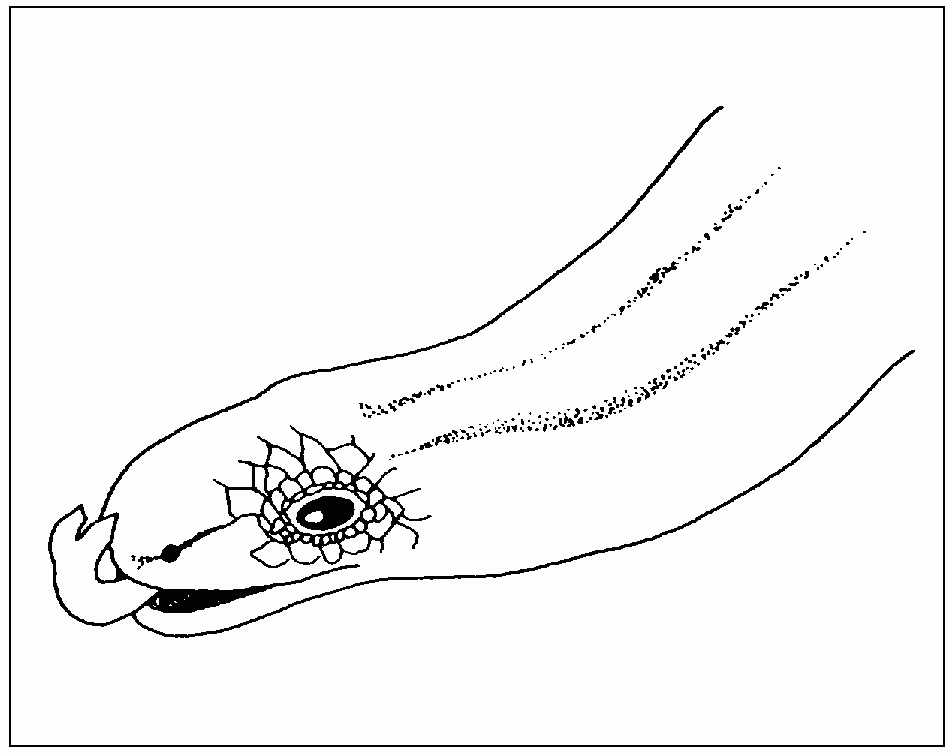
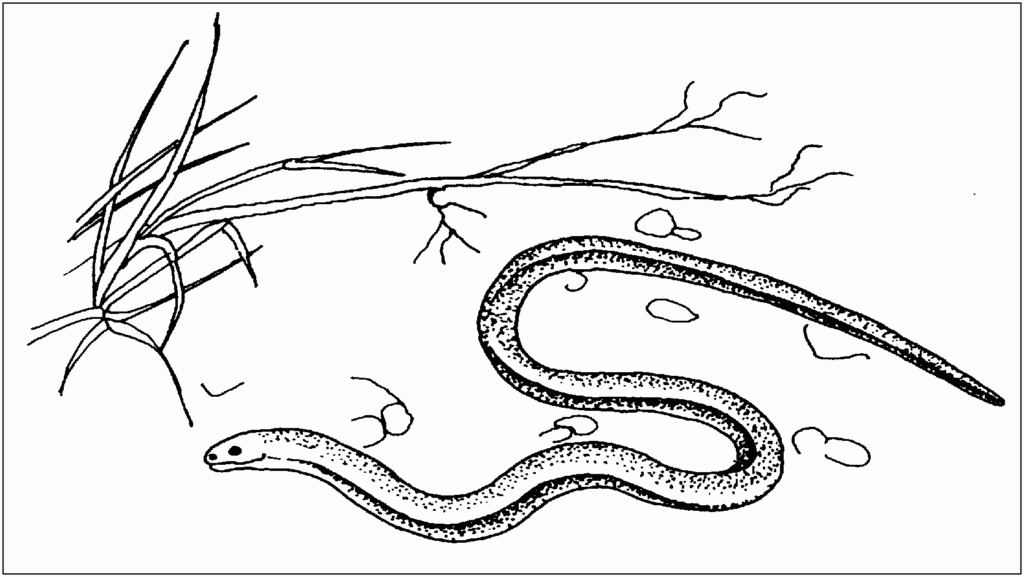
Unterschiede gegenüber Schlangen
- mit Lidern verschliessbare Augen
- kann den Schwanz abwerfen
- gleichartige Schuppen rund um den Körper
- ungelenke Fortbewegungsart
- keine Oberlippenaussparung für das Züngeln
- kleine Reste von Schulter- und Beckengürteln
Paarung
Das Männchen hält mit seinen Kiefern das Weibchen hinter dem Kopf fest und umschlingt es dann knapp vor der Körpermitte, um die Paarung einleiten zu können.
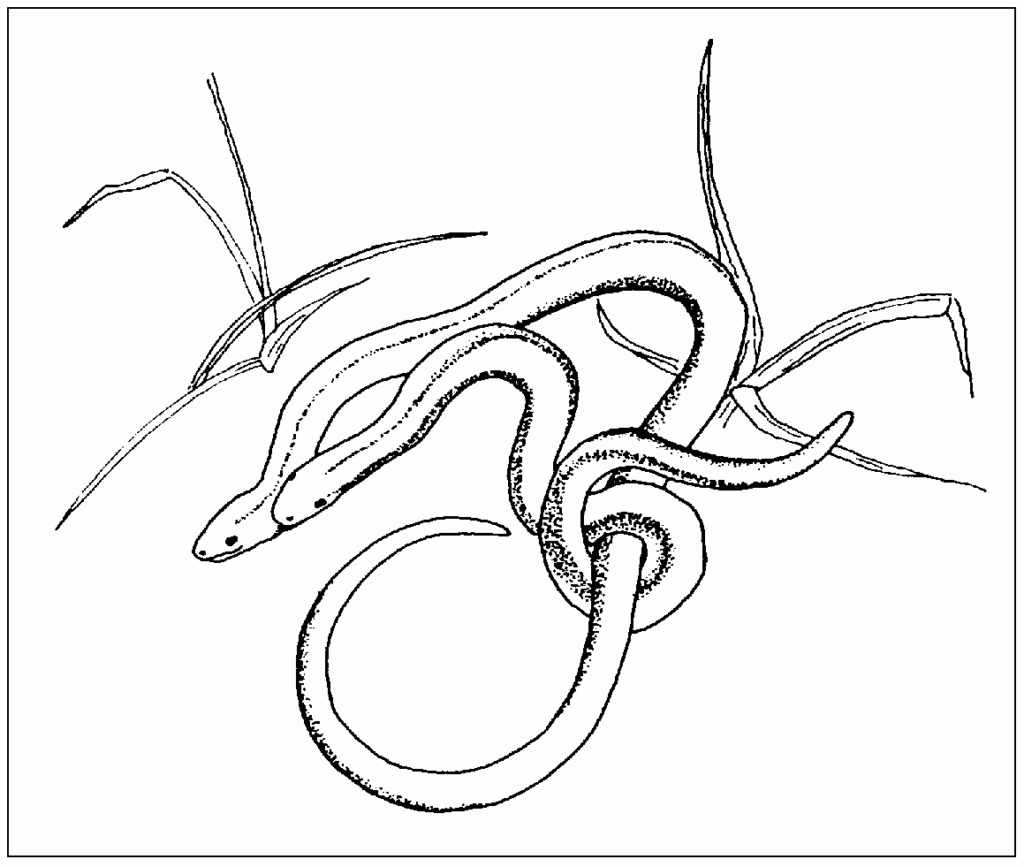
Aus der Kinderstube der Blindschleichen
Geburt
Nach 3 Monaten Tragzeit legen die Weibchen 8–12 Eier mit schlüpfreifen Jungen. Bisweilen platzen die gallertigen, dünnen Eihäute schon bei der Geburt. Im Innern einer intakt gebliebenen Eihülle erkennen wir zwischen dem aufgerollten Tier noch die Reste der Dottersubstanz. Noch nicht freie Tiere werfen ihren Kopf kräftig zur Seite und zerreissen damit ihre Hülle.
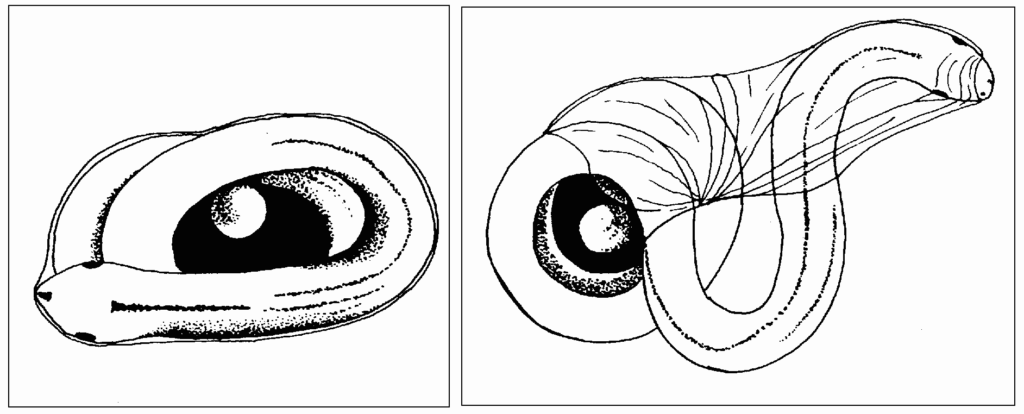
Entwicklung
Frisch geschlüpfte Blindschleichen messen 6 cm, gehen sehr bald eigene Wege und suchen ganz kleine Nacktschnecken. Mit 3 Jahren sind sie geschlechtsreif. Ausgewachsen messen sie 40–50 cm und können in Gefangenschaft über 25 Jahre alt werden.
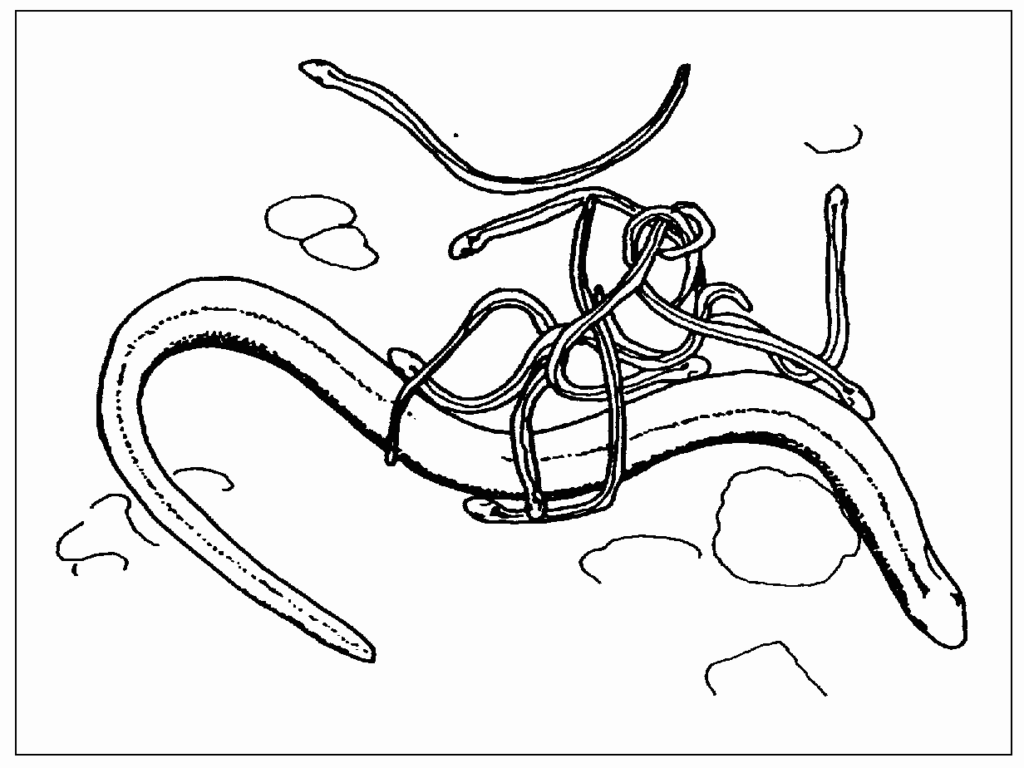
Die Zauneidechse, eine Sonnenanbeterin
Lebensweise
An warmen, sonnigen Frühlings- und Sommertagen können wir auf trockenen Hängen, Bahn- und Strassendämmen, aber auch an Wegrändern und auf Steinmäuerchen handlange, schlanke Tiere beobachten, welche sofort die Flucht ergreifen, wenn wir in ihre Nähe kommen: Eidechsen. Bei kühlem, nassem Wetter und während des ganzen Winterhalbjahres sind die wärme-liebenden Tiere von der Oberfläche verschwunden. Sie halten einen Winter-schlaf, dösen aber auch in sommerlichen Schlechtwetterperioden halb starr vor sich hin. Sie müssen ihre Körpertemperatur derjenigen der Umgebung anpassen; es sind also im Unterschied zu den gleichwarmen Säugern und Vögeln wechselwarme Tiere wie die Schlangen und Amphibien. Die Haut der Eidechsen hat keinerlei Vorrichtungen, wie etwa Haare oder Federn, mit denen Körperwärme aufgestaut werden könnte. Die glatten Hornschuppen schützen den Körper wohl vor Austrocknung und Verletzungen, nicht aber vor Wärmeverlust. In der Kälte geht es ihnen wie unseren ungeschützten Fingern an kalten Wintertagen: sie verlieren die Kraft, werden steif und wie leblos. In der Sonne aber nimmt die Eidechse die Wärmestrahlung rasch auf, wird heissblütig und äusserst temperamentvoll.
Aussehen
In der Nordostschweiz treffen wir am häufigsten die Zauneidechse. Ausgewachsen erreicht sie eine Länge von 20 cm. Beide Geschlechter besitzen auf dem Rücken ein braunes, geflecktes Band. Im Frühjahr tragen die Männchen leuchtend hellgrüne Flanken zur Schau, währenddem die Weibchen mit einem hellbraunen, weit weniger auffälligen Kleid erscheinen. Die Unterseite ist bei beiden Geschlechtern heller.
Selbstverstümmelung
Im Vergleich zu den in der Südschweiz häufig vorkommenden Mauer- und Smaragdeidechsen ist die Zauneidechse weder besonders scheu noch besonders flink. So lässt sie sich auch verhältnismässig leicht von Hand fangen. Man hüte sich aber, sie am Schwanzende anzufassen. Wie jede andere Eidechse kann sie durch Selbstamputation den Schwanz abwerfen und sich aus dem Staube machen. Vom sechsten Schwanzwirbel an hat jeder Wirbelkörper eine vorgebildete Bruchstelle, entsprechende Schwächestellen liegen auch im Bindegewebe und in der Muskulatur, so dass durch ein kräftiges Zusammenziehen der Ringmuskeln des betreffenden Abschnittes der dahinterliegende Schwanzteil abgetrennt werden kann. Noch lange zappelt dann das herrenlose Schwanzstück hin und her. Der Angreifer und Verfolger wird so genarrt, und die verstümmelte Eidechse kann sich in Sicherheit bringen.
Der fehlende Schwanzteil wird teilweise (bei Jungtieren praktisch ganz) erneuert. Das Stützelement ist jedoch nur noch ein ungegliederter Knorpelstab, der nicht mehr brechen kann.
Nahrung
Die Zauneidechsen fressen u.a. Würmer, Schnecken, Insekten, Spinnen. Die geschnappte Beute wird mit den vielen spitzen Zähnen festgehalten und unzerkaut verschluckt. Ab und zu bekommen ihnen die hastig verschlungenen Tiere nicht, dann erbrechen sie die ganze Tagesbeute mit krampfartigen Bewegungen. Man findet gelegentlich kaum verdaute, fingergrosse Würste zusammengepresster Heuschrecken.
Rivalenkämpfe
Während der Paarungszeit im Frühling können wir ab und zu Rivalenkämpfe unter Männchen beobachten. Sie beginnen mit der katzenbuckelartigen Imponierstellung. Dann richten die Tiere Vorderbeine und -körper auf, senken den Kopf und krümmen den Nacken. In dieser steifen Haltung nähert sich ein Männchen dem andern. Anschliessend gestattet einer der Rivalen, dass ihn der andere am Nacken packt. Das tun sie dann abwechselnd, bis einer spürt, dass ihm der andere überlegen ist. Er erkennt das wahrscheinlich am festen Zugriff seines Partners. Der Verlierer unterwirft sich in recht eigenartiger Weise. Er legt sich zunächst flach auf den Boden, trampelt dann an Ort und Stelle und läuft schliesslich davon. Der Rivalenkampf gleicht einem Turnier, es gibt keinen Toten oder Verletzten, nur einen Besiegten.
Paarung
Das Paarungsverhalten des Männchens gleicht teilweise dem Rivalenkampf-verhalten. Zunächst nähert sich das Männchen dem auserkorenen Weibchen in einer ähnlichen, ebenso gebuckelten Haltung. So erkennt das Weibchen die Absicht seines Partners. Ist es bereit, den Antrag anzunehmen, so bleibt es stehen und fordert damit den Heiratslustigen auf, sein Werbespiel fortzusetzen. Das Männchen packt nun mit den Kiefern den Schwanz des Weibchens, was diesem scheinbar nicht ganz passt, denn es leistet – «wohl nur der Form halber?» – einen geringfügigen Widerstand. Schliesslich beisst sich das Männchen am Rücken seiner Partnerin fest. Diese hebt den Vorderteil des Schwanzes und ermöglicht so die Paarung.
Eiablage und Entwicklung
Das Weibchen legt die 6–14 Eier erst Tage nach der Paarung in warme, etwas feuchte, vielfach vorher mit den Vorderbeinen ausgegrabene Löcher ab. Die Schale der 1.5 cm langen, weissen Eier ist pergamentartig weich. Die Eidechsenkinder schlüpfen 7–8 Wochen später aus. Der Zeitpunkt hängt stark von den örtlichen Temperaturverhältnissen ab. Die Mutter kümmert sich nach der Eiablage weder um ihre Eier, noch später um ihre geschlüpften Kinder. Die Jungen haben und wissen sich selbst durchs Leben zu schlagen. Nach einigen wenigen Jahren erreichen die Überlebenden die Grösse ihrer Eltern.
Eidechsen der Alpennordseite
Zauneidechse (Männchen)
20–24 cm lang; kurzbeinig, eher gedrungen; kurzer, niederer Kopf; auf der Rückenmitte braunes Band mit hellen Flecken; Männchen im Frühjahr mit leuchtend grünen Flanken; Weibchen grau oder braun.
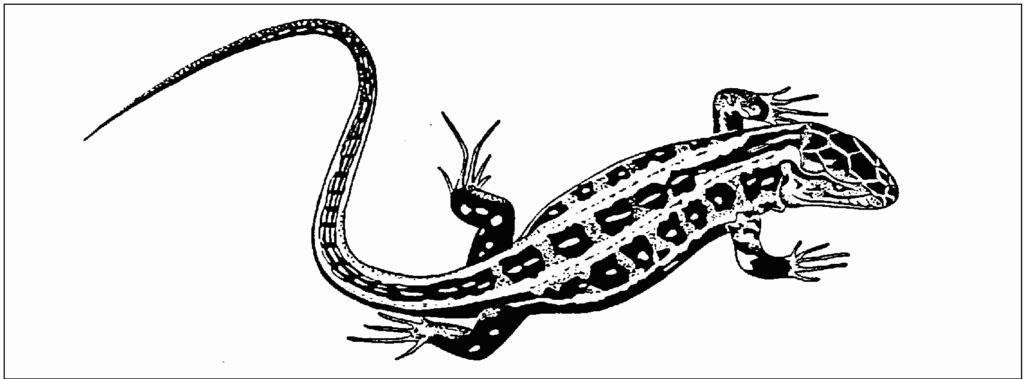
Wald- oder Bergeidechse
16–18 cm lang; kurzbeinig; kleiner, ziemlich runder Kopf; Oberseite grau bis rötlich oder dunkelbraun, oft mit kleinen hellen oder dunklen Flecken; Männchenunterseite orange bis rot mit schwarzen Punkten; Weibchenunterseite weiss bis rosa ohne Flecken. Steigt bis auf 3000 m; ist vivipar.
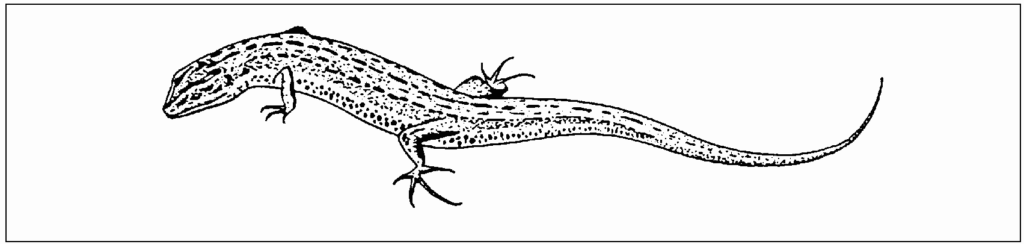
Mauereidechse (kommt im Wald nicht vor)
18 cm lang; sehr schlank; abgeflachter Körper; langer Schwanz; Oberseite meist bräunlich oder grau, Männchen mit netzartigen Flecken, Weibchen mit hellgesäumtem, dunklem Längsband auf den Körperseiten. In trockenem, warmem Gelände, bis auf 1700 m. Häufig nur auf der Alpensüdseite.
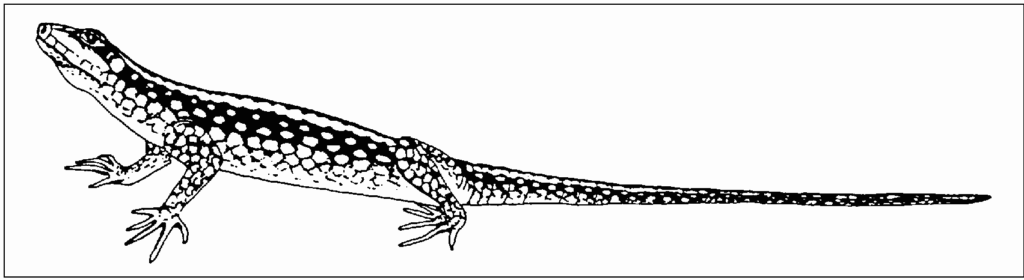
Eigenheiten des Körperbaues und der Fortbewegung
Selbstverstümmelung
Vom sechsten Schwanzwirbel an hat jeder Wirbelkörper eine vorgebildete Bruchstelle. Entsprechende Schwächestellen liegen auch im Bindegewebe und in der Muskulatur, so dass durch kräftiges Zusammenziehen der Muskeln eines bestimmten Abschnittes der dahinterliegende Schwanzteil abgetrennt werden kann.
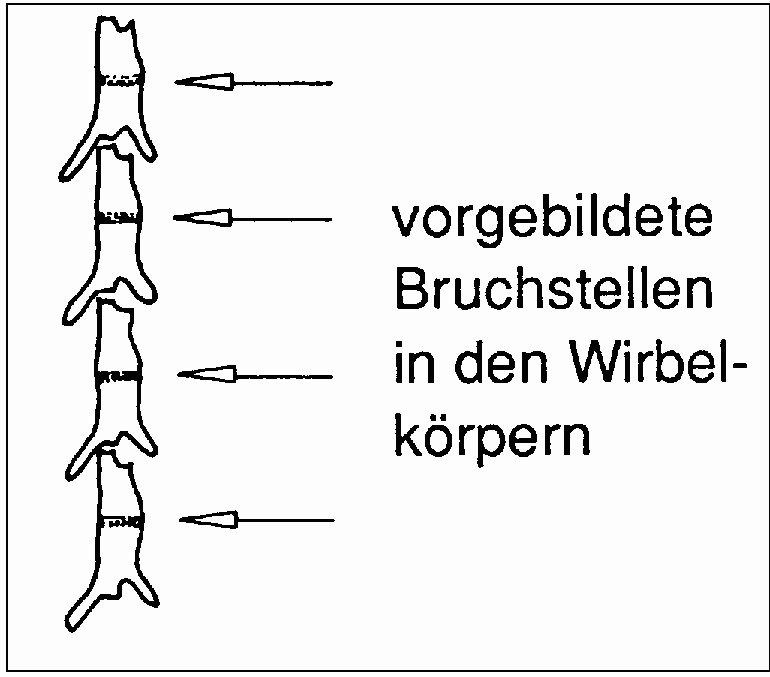
Die Fortbewegungsart der Eidechsen heisst Schubkriechen
Die seitlich abstehenden Eidechsenbeine können den Körper kaum tragen, darum rutscht das Tier auch mehr oder weniger auf dem Bauch. Die Wirbelsäule biegt sich s-förmig abwechselnd nach links und nach rechts, und die Beine schieben den Körper nach. Die Schreitbewegungen verlaufen wie folgt: linkes Vorder- und rechtes Hinterbein, dann rechtes Vorder- und linkes Hinterbein.
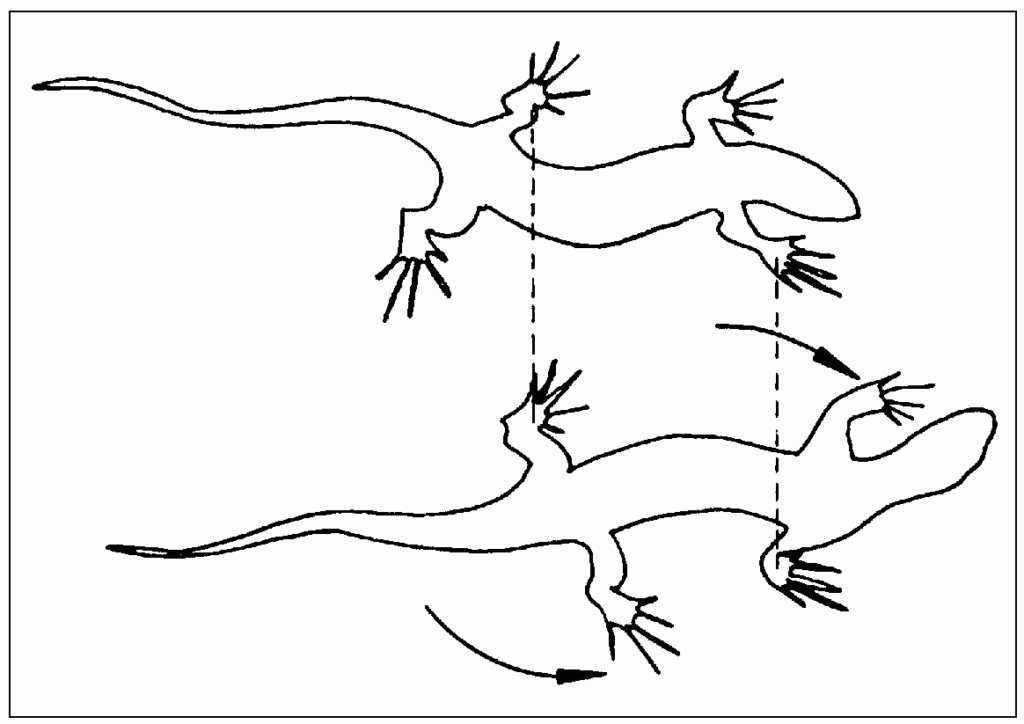
Die Schlingnatter – ein seltener Bewohner sonniger Waldränder und warmer Trockenwiesen
Schutz
Es ist nicht einfach, diese harmlose und ungiftige Schlange aufspüren und beobachten zu können. Das hat mehrere Gründe. Einmal haben die vielen Strassen, die grossen Überbauungen und die intensive landwirtschaftliche Nutzung des noch verbleibenden und geeigneten Bodens den ursprünglichen Lebensraum vieler Tiere arg beschnitten. Dann tummeln sich in den Restflecken der freien Natur an sonnigen Tagen mancherorts so viele Menschen, dass die ruheliebenden Tiere – und zu ihnen gehören die Schlangen – gestört und vertrieben werden. Schliesslich leiden gerade die Schlangen noch immer unter der blinden Verfolgungswut uneinsichtiger Mitmenschen, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun, wenn sie diese Kriechtiere totschlagen.
Die drohende Gefahr der Ausrottung gewisser Tierarten führte im Jahr 1967 zum Bundesgesetz des totalen Schutzes aller in der Schweiz lebenden Kriechtiere, Amphibien, Fledermäuse und Roten Waldameisen. Diese dringend nötige Massnahme nützt aber nur etwas, wenn gleichzeitig auch die Lebensräume der seltenen Tiere erhalten und geschützt werden. Und da gibt es noch viel zu tun.
Lebensraum und Lebensgewohnheiten
Die scheue Schlingnatter lebt vor allem dort, wo sie durch die Menschen wenig gestört wird. So finden wir sie noch in sonnenlichtdurchfluteten Schneisen und Lichtungen unserer Wälder, an warmen Waldrändern, nicht selten auch an Böschungen und in stillgelegten Steinbrüchen und Kiesgruben. Sie braucht neben Ruhe und Wärme vor allem auch die richtigen Beutetiere, und das sind in erster Linie Zaun- und Bergeidechsen, Blindschleichen, ab und zu auch kleinere Kreuzottern und Vipern, also Giftschlangen, selten auch junge Mäuse und Jungvögel.
Das mit kiellosen, glatten Schuppen bedeckte Schlänglein erreicht eine Länge von wenig mehr als einem halben Meter. Sein silbergraues oder braunes Kleid tarnt vorzüglich. Die Schlingnatter weiss das offensichtlich, denn sie bleibt auch dann auf ihrem Sonnenplatz liegen, wenn der Mensch nahe an ihr vorbeigeht. Sie gleicht also so dem von ihr ausgewählten Untergrund, dass man sie selten entdeckt. Will man aber nach ihr greifen und bleibt ihr keine Möglichkeit mehr zur Flucht, so wehrt sie sich recht eindrucksvoll. Sie biegt den Kopf und Hals zurück, zischt und stösst vor, um zu beissen. Neben der Zornnatter ist sie wohl die bissigste Schlange unseres Landes. Ihre winzigen Zähne vermögen jedoch unsere Haut kaum zu durchdringen.
Das ruhige Ausharren an Ort bringt der Schlingnatter auch beim Beutefang Vorteile. Die äusserst aufmerksamen und schnellen Eidechsen können ja nicht verfolgt, sondern müssen durch einen überraschenden Zugriff überwältigt werden, wenn sie zufälligerweise in die Nähe einer hungrigen Schlingnatter kommen. Die einmal gepackte Beute wird dann mit zwei bis drei Windungen umschlungen und wenn immer möglich erdrosselt. Diese Gewohnheit gab der Schlange den Namen.
Ab und zu finden wir einmal eine Schlingnatter mit einer ausgesprochen starken Zeichnung, die vielleicht sogar zickzackartig über den Rücken verläuft. Wenn wir dann nicht auf die für die Schlingnatter typischen Merkmale, die glatten, ungekielten Schuppen, die runde Pupille und auf das durch das Auge verlaufende, waagrechte, braune Band achten, so ist eine Verwechslung mit der giftigen Kreuzotter möglich.
Paarung und Wochenstube
Die Paarungszeit liegt im Mai. Das Männchen packt sein Weibchen mit dem Maul hinter dem Kopf und umschlingt es mit einigen Windungen. Es sieht fast aus, als betrachte das Männchen sein Weibchen als Beutetier. Niemals sind aber Biss und Schlingen so stark, dass Verletzungen entstehen. Im August bringt dann die Schlangenmutter ihre 12–18 Kinder zur Welt. Die Schlingnatter legt als einzige der ungiftigen Schlangen nämlich keine Eier, sondern trägt ihre Jungen aus wie die giftigen Kreuzottern und Vipern. Eine Schlingnatterwochenstube ist ein reizendes Schauspiel: In feinste Häutchen verpackt, gelangen die Jungen einzeln ans Tageslicht. Mit ruckartigen Bewegungen öffnen sich die bläulich durch die Eihäute schimmernden Schlänglein den Weg in die Welt. Sie sind nur wenig dicker als ein Zündholz und knapp 12 cm lang, züngeln bereits und gleichen in der Zeichnung schon deutlich ihren Eltern. Jahre vergehen, bis die wenigen Überlebenden dieser Kinder erwachsen sind. Ohne Unglücksfall kann dann eine Schlingnatter etwa 15 Jahre alt werden.
Sehen, Hören, Riechen
Obwohl die Schlange schlechte Augen, überhaupt keine Ohren und nur eine verkümmerte Nase hat, entgeht ihr auch die leiseste Bewegung in ihrer Umgebung nicht. Sie spürt den nahenden Tritt der Menschen mit Hilfe des hochentwickelten Sinnes für die Wahrnehmung von Bodenerschütterungen, einer Art Tastsinn, und unterscheidet ihre Beutetiere durch eine besondere Art der Geruchswahrnehmung. Die Schlangen brauchen nämlich ihre Zunge nicht wie wir zum Schmecken, sondern vor allem als Geruchsorgan. Wir verstehen jetzt, warum wir sie meistens züngelnd sehen. Die lange, zweigeteilte Zunge flackert vor allem bei erregten Schlangen wild in der Luft herum, schlägt nach oben und weicht immer wieder durch das eigens dafür ausgesparte Loch zwischen den fest geschlossenen Kiefern in die Mundhöhle zurück. Die heftige Tätigkeit der Schlangenzunge zeigt nicht nur den Grad der Erregung; an der feuchten Oberfläche bleiben feinste Geruchsteile der zu untersuchenden Luft haften, die in die Mundhöhle zurückgezogen werden. Nicht sichtbar für uns ist der nun folgende Vorgang: Die beiden haarfeinen Zungenspitzen greifen durch zwei kleine Löcher im Gaumendach ins eigentliche Riechorgan und laden dort die Duftpartikelchen ab. Hier sitzen Sinneszellen, die diese Duftstoffe untersuchen, und Nervenbahnen leiten den Befund ins Gehirn weiter, das dann entsprechend reagieren kann.
Wachstum und Hautwechsel
Die Schlange kann nur wachsen, wenn sie das mit der Zeit zu eng gewordene Kleid ausziehen kann. Das ist nur während der warmen Jahreszeit möglich und geschieht bei jungen Schlangen fünf- bis sechsmal im Verlaufe eines Sommers. Auch erwachsene Schlangen brauchen ab und zu ein neues Kleid; sie häuten sich aber während der gleichen Zeit nur noch ein- bis zweimal. Wachstum und Hautwechsel sind also stark von der Aussentemperatur abhängig. Bei kühlem Wetter hungern sie wochenlang. Eigenartigerweise verlieren sie dabei praktisch kein Gewicht. Sie haben aber dann auch kein Bedürfnis, sich zu häuten.
Sehen wir uns diesen interessanten Vorgang nun einmal an. Er wird eingeleitet, indem sich zwischen die äussere, abzustossende und die neue, darunterliegende Haut eine schleimige Flüssigkeit ergiesst. Die Aussenhaut weicht sich auf und löst sich ab. Am besten sehen wir die milchige Flüssigkeit zwischen den beiden die Augen bedeckenden Häuten, den zusammengewachsenen, durchsichtigen Augenlidern. Mit den blaugrau getrübten Augen ist die Schlange praktisch blind und darum in ihrer Unsicherheit äusserst angriffslustig. Nach Tagen oder Wochen werden die Augen wieder klar, ein Zeichen dafür, dass die eigentliche Häutung unmittelbar bevorsteht. Jetzt kriecht sie nervös umher, stösst wie betrunken an allerhand Erdvorsprünge, Steine, Zweige und Wurzeln, um die alte Haut an der Schnauzenspitze aufzustossen. Bald legen sich die vordersten Hautränder über den Kopf zurück, und die Schlange entledigt sich ihres alten Kleides, wie wir in der Hast enge Strümpfe auszuziehen pflegen. Vor uns liegt das frisch gehäutete Tier in seinem neuen Sonntagskleid. Es liebt das Leben wie wir Menschen. Gönnen wir es ihm, noch mehr, versuchen wir, auch unsere Schlangen zu achten!
2012 endeckte René Bertiller bei Natuschutzarbeiten am Südhang des Beerenberges eine Schlingnatter. Sie lebt also noch auf Winterhurer Boden!
Lebensraum, Beutetiere und besondere Merkmale der Schlingnatter
Lebensraum
Warme, ungestörte Orte, wo auch die richtigen Beutetiere vorkommen:
- Böschungen und Trockenwiesen
- warme Waldränder, sonnige Waldlichtungen und Schneisen
- stillgelegte Steinbrüche und Kiesgruben. Selten!
Beutetiere
Eidechsen, Blindschleichen, junge Mäuse, Jungvögel, auch kleine Kreuzottern und Aspisvipern. Die Schlingnatter beisst die Beutetiere (ohne Gift) und versucht sie dann durch Umschlingen zu erdrosseln.
Besondere Merkmale
Zierliche, schlanke, ungiftige, bissige, aber harmlose Schlange von ungefähr 50 cm Länge. Gleich lang sind auch unsere beiden giftigen Schlangen, Verwechslungen sind also durchaus möglich.
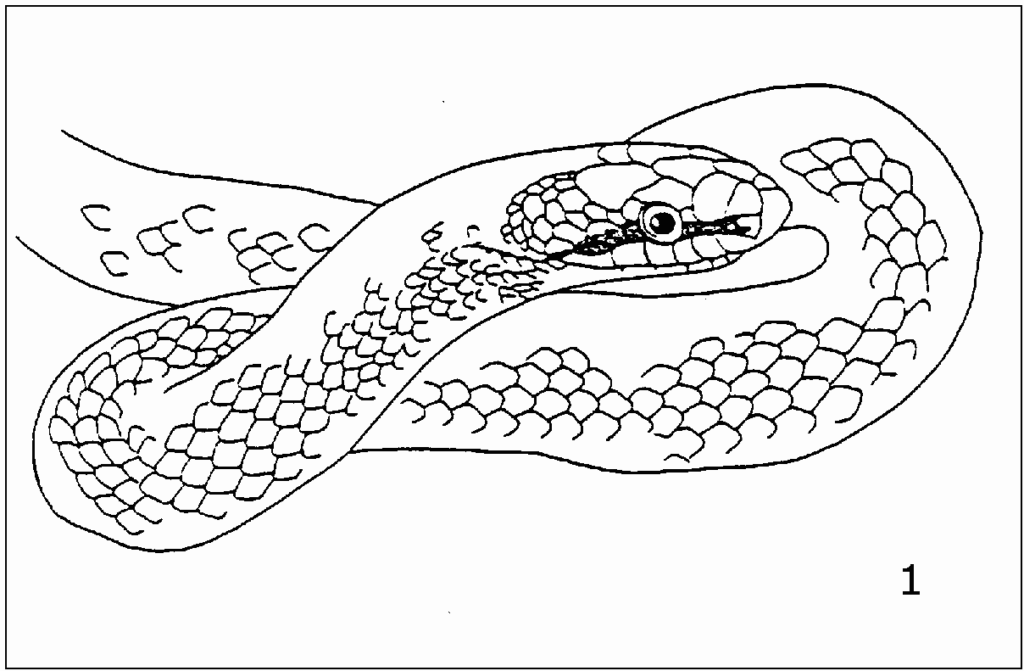
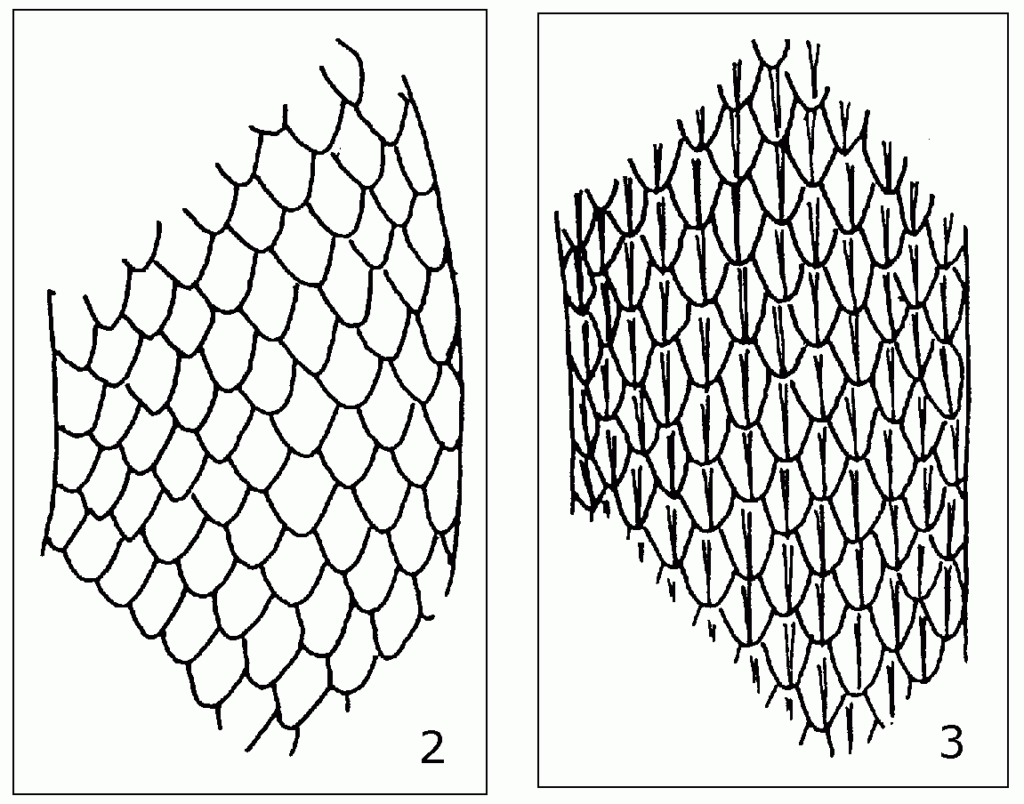
- Kiellose, glatte Schuppen haben der Schlingnatter auch den Namen Glattnatter eingetragen.
- Kiellose, glatte Schuppen der Schlingnatter
- Gekielte Schuppen der Ringelnatter
Vom Sehen, Hören und Riechen der Schlangen
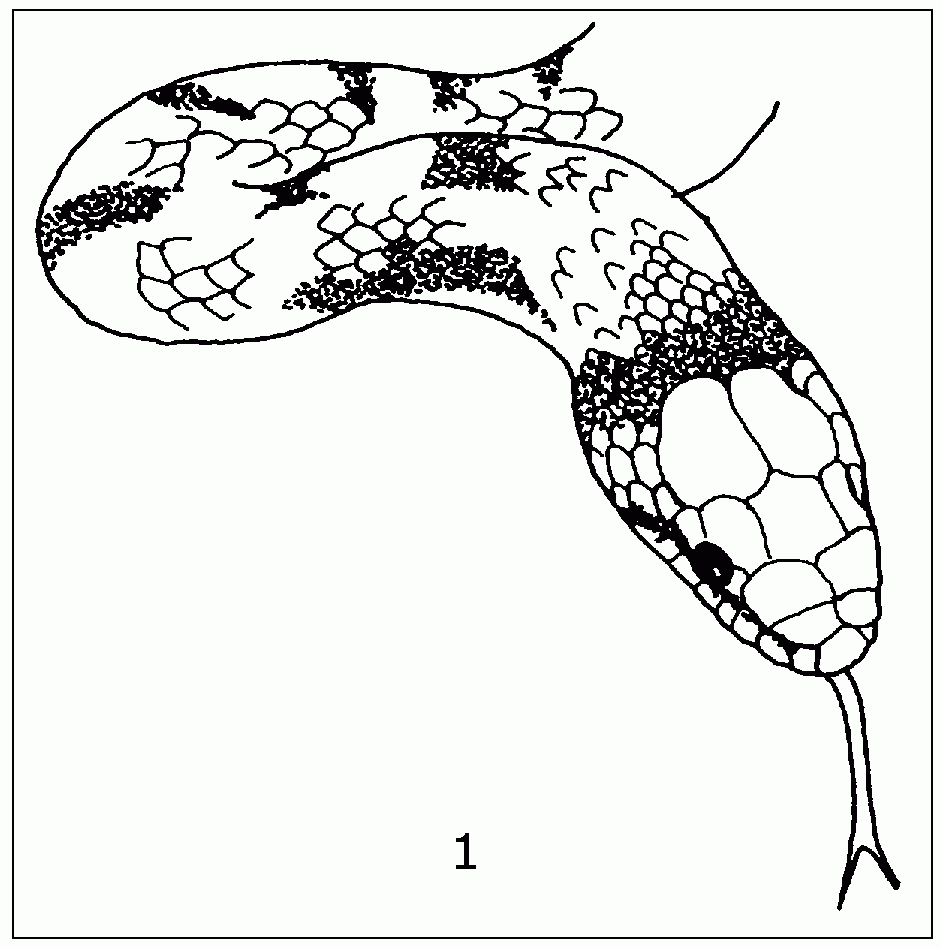
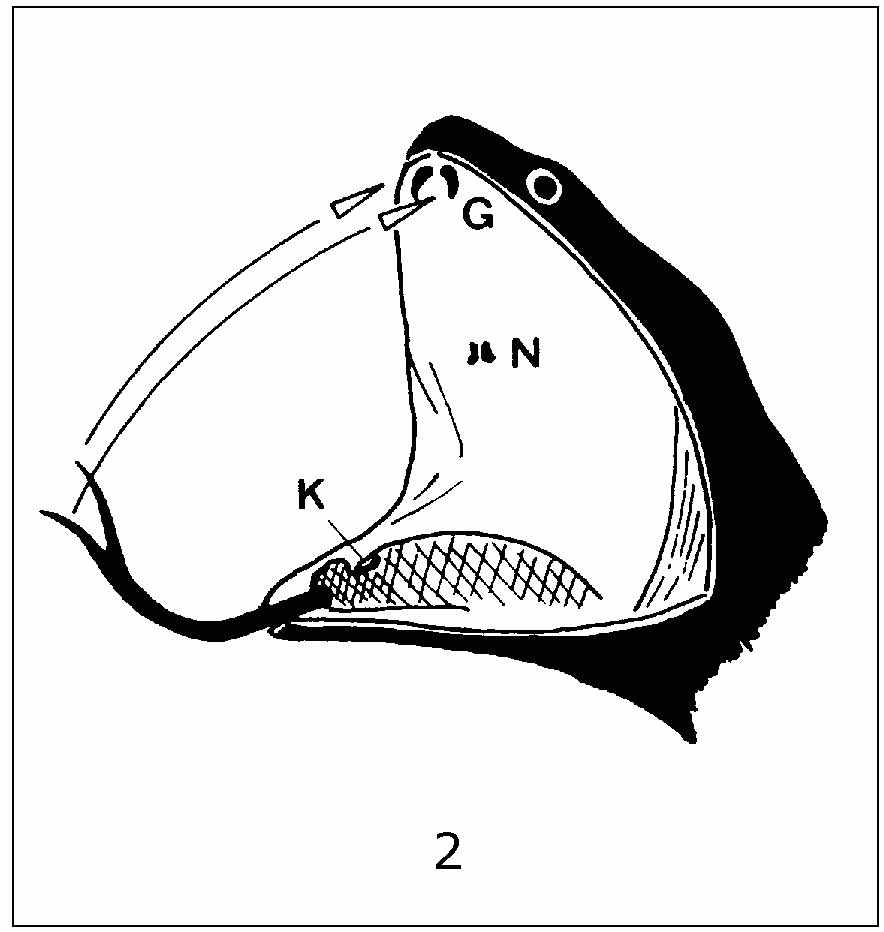
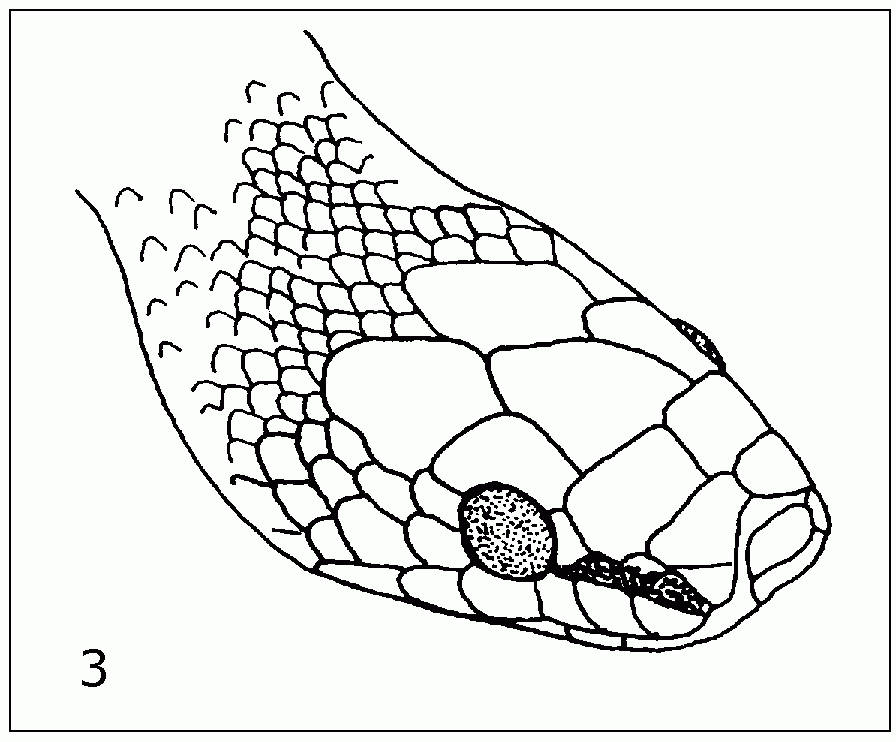
- Schlangen haben schlechte Augen, keine Ohren und auch eine verkümmerte Nase, dafür einen sehr hochentwickelten Sinn für die Wahrnehmung von Erschütterungen und eine besondere Art der Geruchswahrnehmung.
- Sie «züngeln» oft und schnell und bringen so viele Duftteile, die an den feinen Zungenspitzen haften bleiben, durch zwei kleine Löcher im Gaumendach ins eigentliche Geruchsorgan.
G Gaumengruben = Geruchsorgan
N Einmündung der Nasengänge
K Kehlkopf mit Luftröhreneingang - Die Augenlider sind durchsichtig, aber starr und miteinander verwachsen. Die Schlangen leiten die Häutung ein, indem sie mit einer milchigen Flüssigkeit die alte Haut von der darunterliegenden, neuen ablösen. Die gleiche Flüssigkeit schiebt sich auch zwischen die alten und neuen Augenlider und macht die Schlange während dieser Zeit praktisch blind. In ihrer Unsicherheit reagiert sie dann bei kleinsten Störungen sehr aggressiv.
Schnecken











































Weinbergschnecke
Verbreitung und Lebensraum
Die natürliche Verbreitungsgrenze der Weinbergschnecke dürfte im Norden etwa bei den deutschen Mittelgebirgen liegen, das Hauptverbreitungsgebiet ist Südost- und Mitteleuropa. Darüber hinaus finden wir sie aber auch noch in Dänemark, in den südlichen Teilen von Norwegen und Schweden, in Süd-England und bis nach Mittelitalien hinunter. Während die Tiere vor allem zur Zeit der Römer absichtlich immer wieder an neuen Orten ausgesetzt wurden, sind es heute die Verkehrsmittel von der Eisenbahn über die Autos bis hin zu den Flugzeugen, die sie zufällig in neue Gebiete verfrachten. Sie kriechen an den abgestellten Fahrzeugen hoch und oft auch in sie hinein und werden dann unbeabsichtigt mitgenommen, gelegentlich sogar nach Übersee. Wenn sie an Stellen mit geeigneten Lebensbedingungen abfallen, können sie sich in einem neuen Lebensraum ausbreiten. Mit Gemüse können auch Eier oder ganz kleine Jungtiere die Reise in ein neues Gebiet antreten.
In Weinbergen findet man diese Schnecken kaum mehr. Die Insektizide, die man gegen die wirklichen Rebenschädlinge spritzt, die intensive Bodenbearbeitung und die mineralische Düngung haben sie entweder vernichtet oder dann vertrieben. Das gilt weitgehend auch für die anderen landwirtschaftlich genutzten Kulturflächen. Trotzdem finden die Weinbergschnecken noch genügend Lebensräume, in denen sie leben und sich vermehren können. Gebüsche, Wegränder, verwilderte Gärten, Friedhöfe, Parkanlagen, brachliegende Flächen und Randgebiete von Laub- und Mischwäldern sind heute bevorzugte Aufenthaltsorte. Nicht selten findet man sie auch mitten in lichten Wäldern. Nadelwälder und trockene Hänge besiedeln sie hingegen selten.
Für die Weinbergschnecken spielt der Boden eine sehr wichtige Rolle. Saure Böden meiden sie, schätzen aber Kalkverwitterungsböden und auch lehmige und stark humushaltige Untergründe, wenn sie einen pH-Wert über 7 haben. Weitere Faktoren von grosser Bedeutung sind die Temperaturverhältnisse und die Feuchtigkeit. Günstige Temperaturen liegen für die Schnecke zwischen 12–25°C. In diesem Bereich ist ihre Fresslust am grössten. Unter 8°C ist sie kaum mehr aktiv, und unter 4°C gehen die Tiere in den Winterschlaf. Temperaturen über 26° hemmen ihre Aktivität ebenfalls; kommt dann noch eine niedere Luftfeuchtigkeit dazu, so fallen sie in die Sommerruhe oder gehen sogar zugrunde.
Lebensgewohnheiten
Der weiche, nackte Körper der Schnecken ist praktisch ohne Schutz gegen Wasserverlust. Ähnlich wie die meisten Amphibien meiden sie die direkte Sonnenbestrahlung und halten sich darum tagsüber meistens an schattigen, feuchten Stellen verborgen. Ist die Luft genügend feucht (relative Luftfeuchtigkeit deutlich über 50%), also von der Abend- bis zur Morgendämmerung und an regnerischen Tagen, verlassen sie ihre Verstecke für die Nahrungsaufnahme. Sie fressen im Schnitt 150–200 cm2 Grünblattfläche pro 24 Stunden, können also durchaus schädlich sein.
Die Häuschenschnecken können bei Trockenheit ihren Körper einziehen. Viele Arten sind zudem in der Lage, am Eingang des Häuschens so viel Schleim auszuscheiden, dass daraus nach kurzer Zeit ein pergamentartiges Häutchen entsteht.
Zum Körperbau der Weinbergschnecke
Die Körperabschnitte der Weinbergschnecke sind höchstens andeutungsweise voneinander getrennt. Der lange, weiche Körperteil, mit dem sie kriecht, heisst Fuss. Er geht zuvorderst ohne Einschnürung oder Hals in den Kopf über.
Die längeren Fühler tragen ganz einfache Augen, mit denen die Schnecke Helligkeitsunterschiede und einfache Formen bis auf eine Distanz von ungefähr 30 cm wahrnehmen kann. Mit den kurzen Fühlern riecht und tastet sie. Schon bei ganz leichter Berührung stülpen sich die Fühler vom äussersten Ende nach innen ein. So liegen dann die Augen geschützt im Innern der hohlen Stiele. Bei Gefahr zieht sich der ganze Fuss und Kopf ins Haus zurück.
Ein grosser Teil des Weichkörpers kommt gar nie zum Vorschein. Er liegt als sackartige Ausstülpung des Rückens im Häuschen verborgen. Weil er die inneren Organe enthält, heisst er Eingeweidesack. Er ist von einem Mantel umgeben, dessen Rand am Häuscheneingang einen Wulst bildet. Das sich regelmässig öffnende und schliessende Atemloch im Mantelrand führt in die Mantel- oder Atemhöhle.
Die abgeraspelte Nahrung gelangt in die Mundhöhle, in der die ersten Verdauungsvorgänge stattfinden. Die Speiseröhre zieht sich in geradem Verlauf nach hinten und erweitert sich ohne sichtbare Abgrenzung zum Magen. In den hinteren Teil des Magens münden die beiden Ausführgänge der Mitteldarmdrüse, die grosse Mengen eines bräunlichen Verdauungssaftes produziert. Im Magen findet die Fortsetzung der Verdauung statt. Die Nahrung rutscht dann halb verdaut in die Mitteldarmdrüse, die den grössten Teil des Eingeweidesackes einnimmt. Hier findet der Abschluss der Verdauung und die Resorption der Nährstoffe statt. Die unverdaulichen Reste werden an den Dünndarm abgegeben, dort zusammengepresst und gelangen schliesslich in den Enddarm. Die Afteröffnung liegt in der Nähe des Atemloches. Auch der Harnkanal aus der Niere öffnet sich hier am Schalenrand.
Die Schnecke hat ein offenes Blutgefäss-System. In der Atemhöhle erfolgt der Gasaustausch. Das sauerstoffhaltige Blut fliesst ins Herz und wird von diesem in ein sich verästelndes Gefäss-System mit feinsten Kapillaren gepresst. Aus diesen gelangt es in miteinander verbundene Hohlräume und aus diesen mit Gefässen in die Lunge.
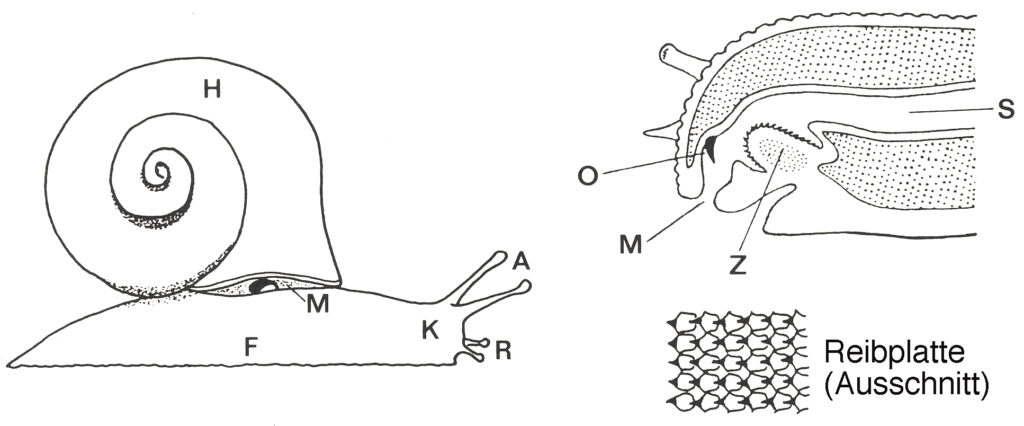
F: Fuss mit Kriechsohle
K: Kopf
R: Riech- und Tastfühler
A: Augenfühler
M: Mantelrand mit Atemloch
H: Haus (birgt viele wichtige Organe)
M: Mundöffnung
O: Oberkiefer
Z: Zunge mit Reibplatte
S: Speiseröhre
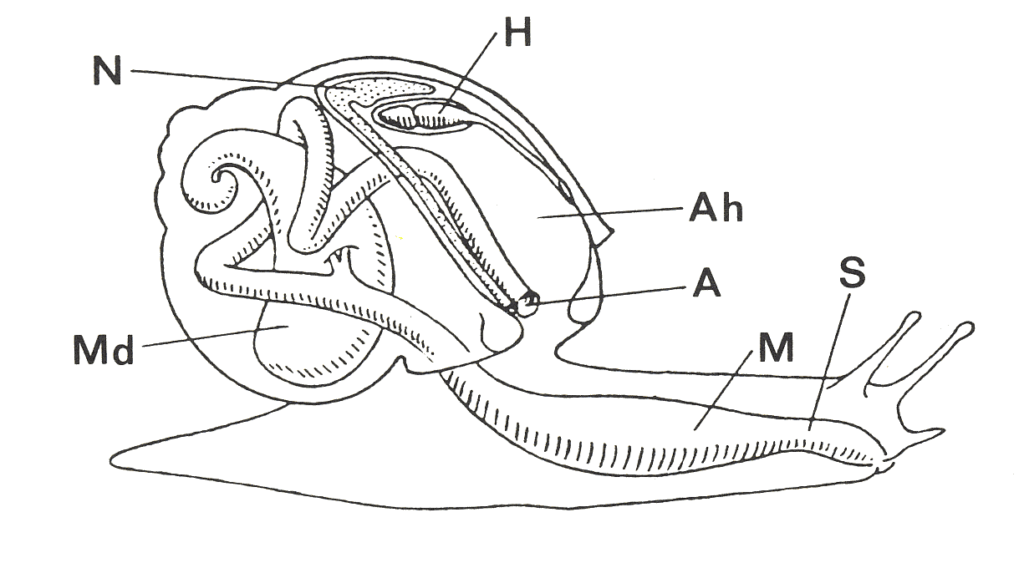
S: Speiseröhre
M: Magen
Md: Mitteldarmdrüse
A: After
N: Niere mit Harnkanal
H: Herz
Ah: Atemhöhle
Fortbewegung im Schneckentempo
Wenn wir eine Schnecke über eine Glasplatte kriechen lassen und die Kriechsohle von unten betrachten, bemerken wir mehrere dunkle Wellen, die von hinten nach vorn über die Sohle ziehen. Bei jeder Welle ist der Schneckenkörper leicht von der Unterlage abgehoben. An diesen Stellen ziehen sich quer über den Körper die Längsmuskelfasern zusammen, was die betroffenen Teile ganz wenig nach vorne zieht. Am ganzen Vorgang sind neben den Längsmuskelfeldern auch noch Quermuskelfelder beteiligt, die in der Längsrichtung des Tieres miteinander abwechseln.
Eine Welle braucht durchschnittlich etwa 20 Sekunden, um über die ganze Länge der Fussohle zu laufen. Mitunter sind nur wenige, oft aber auch bis 12 Wellen gleichzeitig zu sehen. Weinbergschnecken kriechen in der Minute 4–7,5 cm weit, die Geschwindigkeit beträgt also 2,4–4,5 m/h.
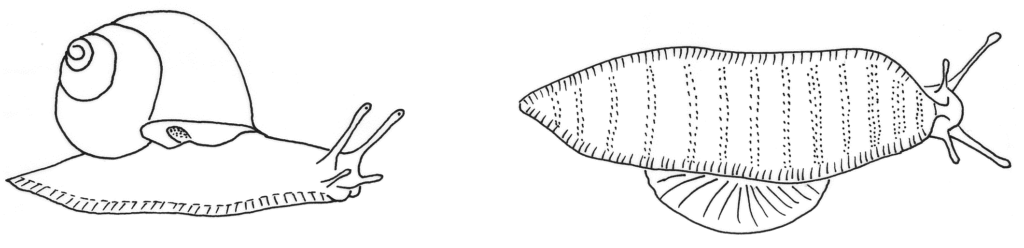
Beim Kriechen scheidet die Schnecke aus einer am Vorderende des Fusses liegenden Drüse fortwährend Schleim ab, so dass sie stets auf einem Schleimband gleitet. Diese Schleimspur ermöglicht das Kriechen über beinahe jede Unterlage, auch an senkrechten Wänden, hängend an Decken oder, bei Wasserschnecken, unter der Wasseroberfläche.
Bau des Schneckenhauses
Das Schneckenhaus besteht zu 98% aus Kalk, den das Tier mit der Nahrung aufgenommen hat. Darum finden wir sie auch nur auf kalkhaltigen Böden. Die Kalkschale ist mit einem feinen, chitinähnlichen Häutchen umgeben, das bis zu einem gewissen Grad vor Säureeinwirkungen schützt. Salzsäure löst ja bekanntlich Kalk auf.
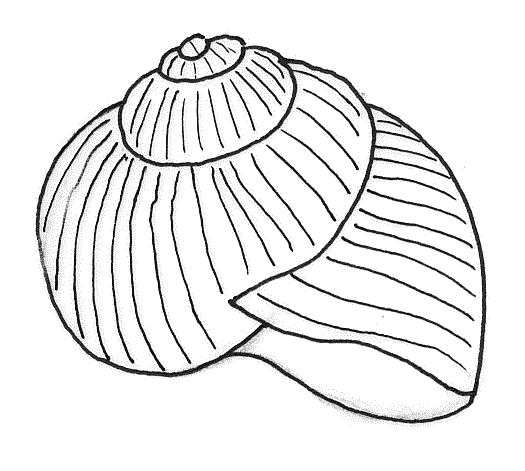
Der Baustoff wird als flüssiger Kalkbrei vom drüsenreichen Mantelrand ausgeschieden und erstarrt sehr schnell. Der Farbstoff stammt aus besonderen Drüsen. Die Bänder oder Zuwachsstreifen verraten, dass das Wachstum nicht gleichmässig, sondern in Schüben erfolgt.
Das Gehäuse einer ausgewachsenen Weinbergschnecke – sie wird 3–7 Jahre alt – weist 5 vollständige Windungen auf, hat eine Höhe von 38–50 mm und einen ebensolchen Durchmesser. Die Windungen sind spiralig um eine Spindel herum angeordnet und verlaufen meistens im Uhrzeigersinn, also rechts herum, wenn wir von der Spitze ausgehen. Schnecken mit links gedrehten Häuschen nennt man Schneckenkönige.
Bei Gefahr, Trockenheit und Kälte zieht sich das Tier mit Hilfe eines sehnigen Spindelmuskels ganz in sein Haus zurück. Er ist oben in der Spindel angewachsen, durchzieht den ganzen Weichkörper und läuft im Kopf aus.
Baumaterial
Das Schneckenhaus besteht fast ausschliesslich aus Kalk, den das Tier mit der Nahrung aufgenommen hat. Aussen herum ist die Schale durch ein widerstandsfähiges Häutchen vor schwachen Säuren geschützt. Salzsäure löst ja bekanntlich Kalk auf.
Bauweise
Drüsen des Mantelrandes scheiden Farbstoffe und einen Kalkbrei aus, der an der Luft sofort erstarrt. Die verschiedenartigen Zuwachsstreifen weisen auf ein Wachstum in Schüben hin.
Das Haus einer ausgewachsenen Weinbergschnecke hat fünf vollständige Windungen, ist 38–50 cm hoch und überall etwa gleich dick. Die Windungen laufen meistens im Uhrzeigersinn herum. Linksdreher nennt man Schneckenkönige. Bei Gefahr zieht ein Muskel, der oben an der Spindel angewachsen ist, die ganze Schnecke ins Haus hinein.
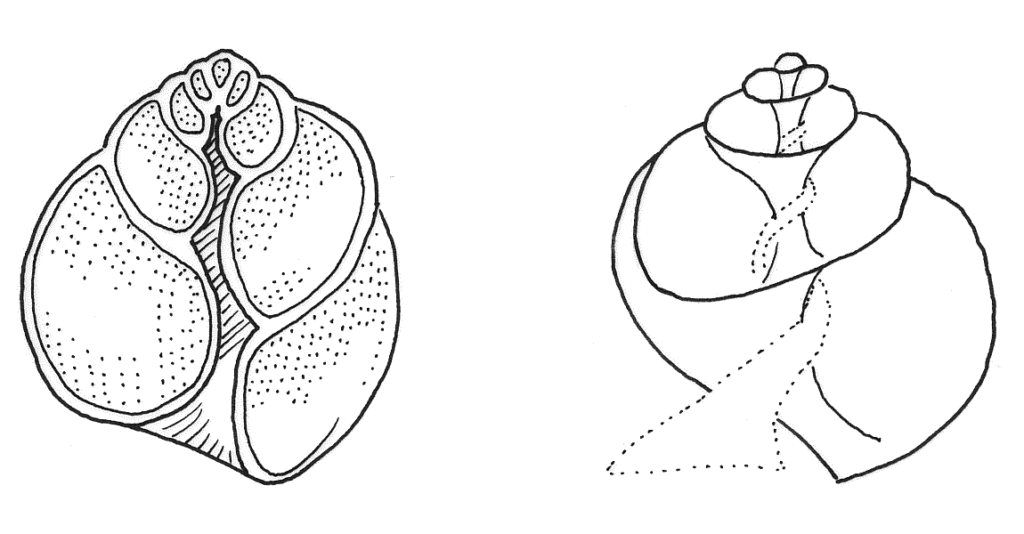
Weinbergschnecken sind Zwitter und paaren sich doch
Zwittrige Tiere besitzen männliche und weibliche Geschlechtsorgane und könnten somit eine Selbstbefruchtung vollziehen. Diese Möglichkeit bleibt aber meistens ungenutzt. Auch die Weinbergschnecken befruchten sich gegenseitig, meistens im Sommer, gelegentlich auch noch im frühen Herbst.
Begegnungen führen nicht selten zu einem Paarungsvorspiel. Die Schnecken heften sich mit ihren Kriechsohlen zusammen, richten sich aneinander auf, vollführen mit dem Vorderkörper wiegende Bewegungen, spielen mit den Fühlern und schiessen meist nach langem Hin und Her einen vierkantigen Kalkpfeil von bis 2 cm Länge in die Fussohle des Partners. Nach einer Ruhepause übergibt in der Regel nur einer der beiden Partner ein Samenpaket, dessen Inhalt in einer speziellen Blase gespeichert wird. Erst jetzt können in der Zwitterdrüse die Eier heranreifen. Die ganze Paarung dauert normalerweise mehrere Stunden.
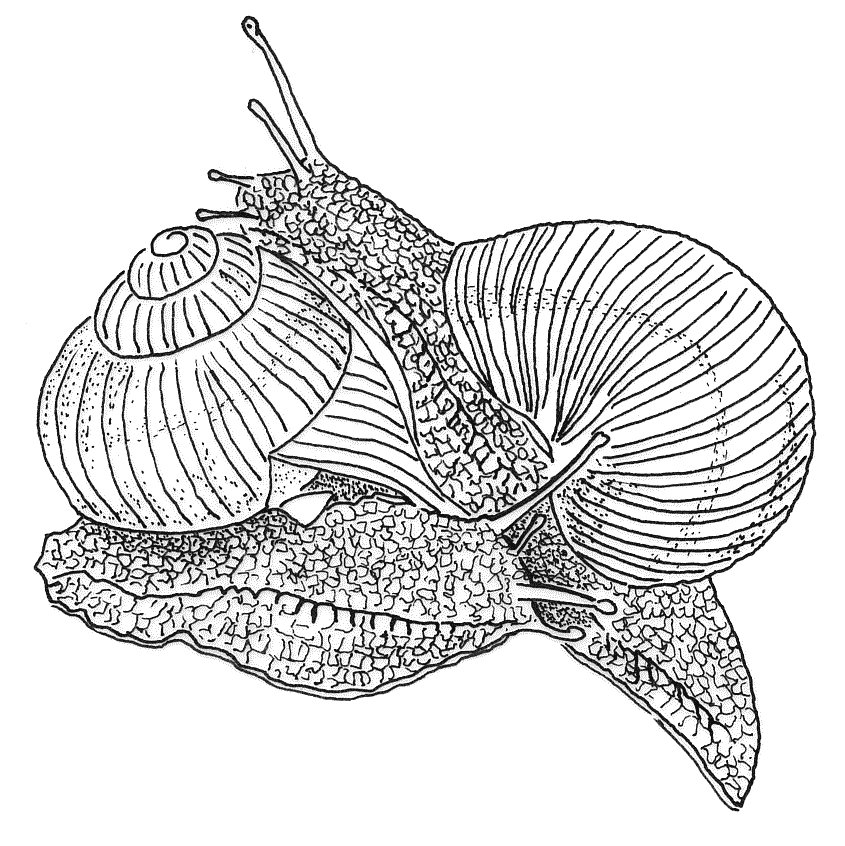
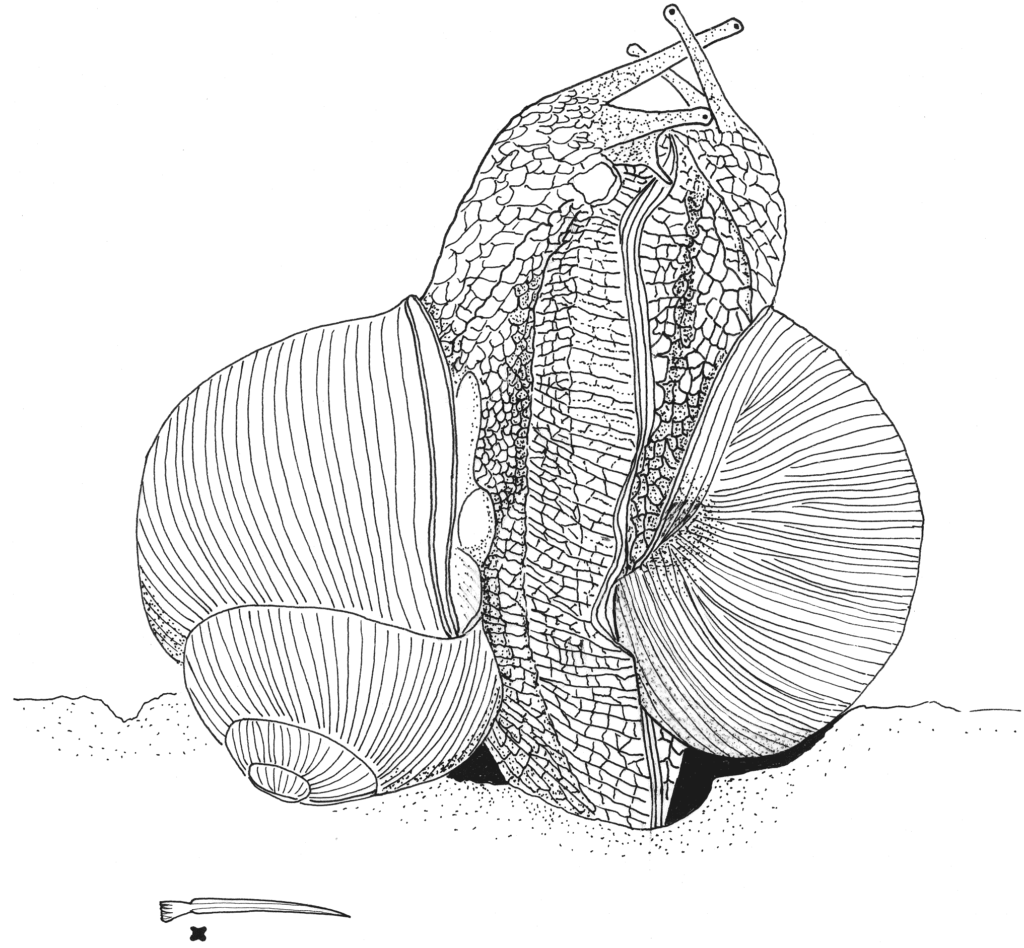
Weinbergschnecken legen ihre Eier in eine Erdhöhle
Vier bis sechs Wochen nach der Paarung gräbt die Weinbergschnecke mit ihrem Fuss an einer feuchten, wenig bewachsenen Stelle mit lockerem Boden eine fingerdicke, mehrere Zentimeter tiefe Röhre, die sie unten zu einer walnussgrossen Höhlung erweitert. Nach der mehrstündigen, schweren Arbeit schaltet sie eine kurze Ruhepause ein und beginnt dann mit der Ablage ihrer 30–70 schleimumhüllten Eier.
Die Geschlechtsöffnung befindet sich auf der rechten Körperseite zwischen dem Mund und der Augenfühlerbasis. Sie öffnet sich nur beim Auspressen der Eier. Die Eiablage zieht sich über eine lange Zeit hin, denn zwischen dem Auspressen der einzelnen Eier verstreichen je 30–40 Minuten. Nach der Eiablage verschliesst die Weinbergschnecke mit der Kriechsohle die Röhre bis zur Eikammer wieder mit Erde. So sind die Eier vor dem Austrocknen und vor Feinden ziemlich gut geschützt.
Die Eientwicklung benötigt mehrere Wochen. Die Zeitdauer ist stark von der Bodentemperatur abhängig. Die schlüpfenden Schneckenkinder tragen bereits ein dünnwandiges, glasartig durchsichtiges Häuschen mit eineinhalb Windungen.
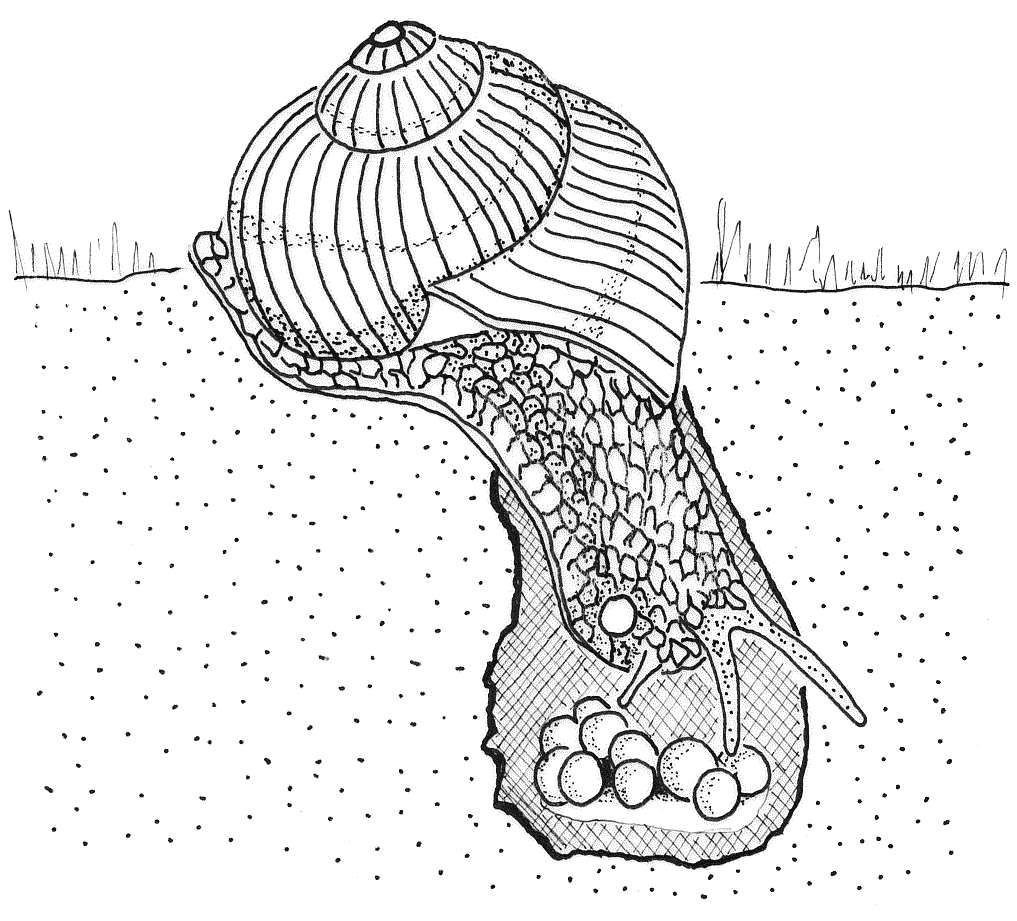
Weinbergschnecken schlafen im Winter hinter einem Kalkdeckel
Im Spätherbst gräbt sich die Weinbergschnecke unter der Pflanzendecke einige Zentimeter tief in die Erde ein und zieht dann alle Weichteile ins Haus. Dann scheiden Drüsen am Mantelwulst einen Kalkbrei aus, der bald zu einem etwa millimeterdicken Deckel erhärtet. Damit wird räuberischen Insekten der Zutritt verwehrt und der Schneckenkörper vor dem Austrocknen bewahrt. Den für die stark reduzierte Atmung nötigen Sauerstoff nimmt die Schnecke durch das poröse Kalkgehäuse auf.
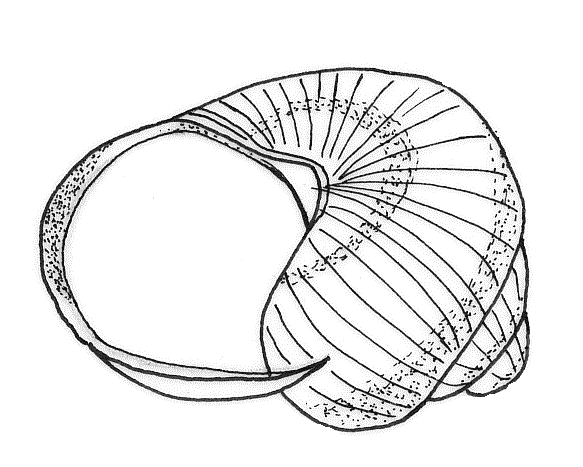
Wenn die Sonne Ende März, anfangs April die oberen Bodenschichten genügend erwärmt, erwacht die Weinbergschnecke aus ihrer Winterstarre. Nach einem warmen Regen drückt sie mit ihrem Fuss den Kalkdeckel nach aussen ab.
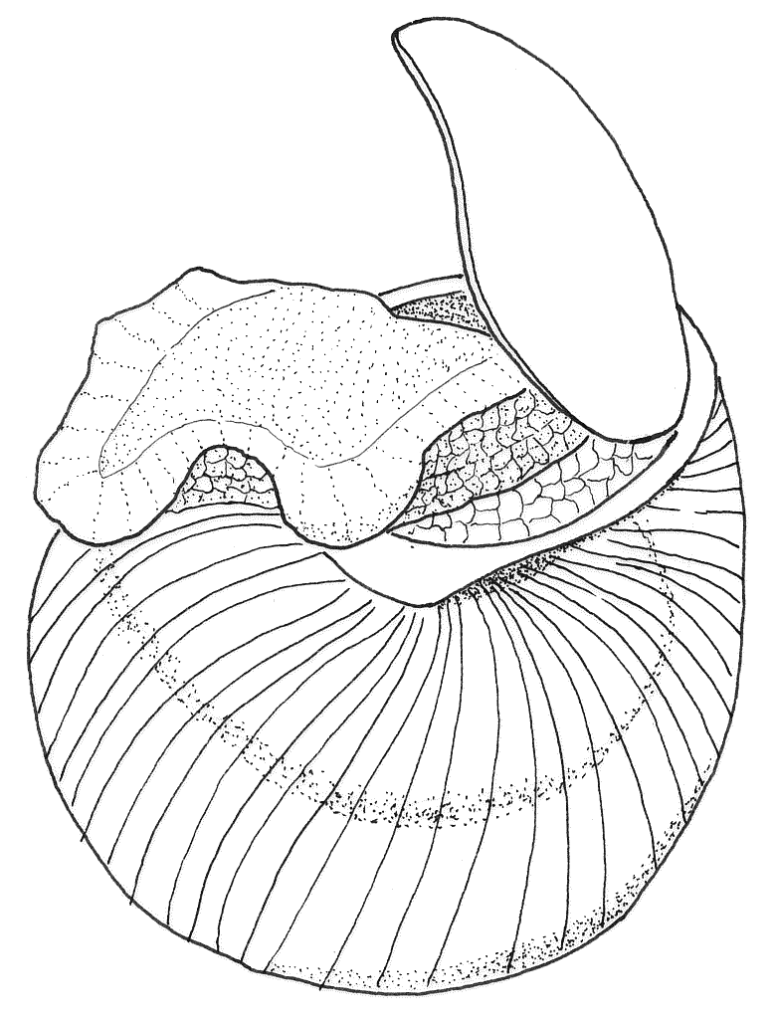
Grosse Egel- oder Tigerschnecke (Limax maximus)
Merkmale
Der Tigerschnecke erreicht ausgestreckt eine Länge bis 13 cm (20 cm). Sie weist auf hellbraunem oder hellgrauem Grund des Mantelschildes ein unregelmässiges, dunkles Fleckenmuster bzw. ein Streifenmuster auf dem Fuss auf. Im Mantelschild hat sich noch ein kleines Schälchen erhalten. Der Kiel ist verhältnismässig kurz und nimmt nur das letzte Drittel des Rückens von der Schwanzspitze bis zum Mantelschild ein.
Lebensweise und Verbreitung
Die Art war ursprünglich in Süd- und Westeuropa beheimatet. Sie hat sich aber inzwischen in ganz Mitteleuropa verbreitet und ist auch in andere Regionen der Welt verschleppt worden. Sie kommt in Auen, Gärten und Parks vor, ist aber auch in feuchten Kellern zu finden. Der Tigerschnecke ernährt sich von Pilzen, welken und abgestorbenen Pflanzenteilen sowie von pilzigen Auswüchsen an totem Holz oder auch von gestorbenen Artgenossen und anderen Nacktschnecken.
Der Tigerschnecke tritt in Mitteleuropa fast nie in Populationsgrössen auf, die Kulturpflanzen spürbar schädigen könnten.
Fortpflanzung
Die Tigerschnecke sind nach etwa 1.5 bis knapp 2 Jahren geschlechtsreif. Alle Schnecken sind Zwitter und verfügen somit jeweils über einen männlichen und weiblichen Genitalapparat. Die verschiedenen Arten haben meist eine komplizierte und ausgeklügelte Fortpflanzungsstrategie mit einem eindrücklichen Paarungsspiel. Die Partner umschlingen einander und seilen sich dann an einem bis zu 40 cm langen Schleimfaden ab. Der Austausch der Samenpakete erfolgt mit fast körperlangen Begattungsorganen. Anschliessend wird das Samenpaket in die Geschlechtsöffnung eingeführt, wo dann die Befruchtung der Eier stattfindet. Selbstbefruchtung ist möglich, zumindest in Gefangenschaft.
Die erste Eiablage erfolgt im Juli/August, die zweite im Juni/Juli des darauffolgenden Jahres. Pro Legeperiode werden zwei bis vier Gelege produziert. Diese enthalten etwa 100–300 Eier je nach Grösse und Ernährungszustand der Tiere. Die Eier sind kugelig bis leicht länglich; sie messen 4–5 mm im Durchmesser. Die Entwicklung dauert je nach Temperatur 19–25 Tage, in Extremfällen auch 45 Tage. Allerdings werden viele Eier durch Parasitenbefall (Nematoden, Milben und Fliegen) vernichtet. Die Tigerschnecke kann zweieinhalb bis drei Jahre alt werden.
abgeändert nach Wikipedia
Bernsteinschnecken
Für unsere Entdeckungsreise wählen wir für dieses Mal einen regnerischen Tag und wandern einem mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Bachufer entlang. Unsere Blicke wenden wir den mit Regentropfen behangenen Pflanzen, insbesondere dem Gras zu und suchen darauf kleine, braune Schnecken mit einem spitz auslaufenden Häuschen. Die Bernsteinschnecken sind nicht selten, sie kommen aber nur an düsteren Regentagen zum Vorschein. Vielfach finden wir an deren Aufenthaltsorten auch Vogelkot in Form von weissen Flecken auf allerlei Pflanzen. Dann allerdings müssen wir die Bernsteinschnecken genau ansehen. Unser Erstaunen wird gross sein, wenn wir plötzlich solche finden, deren Fühler dick wurstartig aufgeschwollen sind und die sich zudem noch rhythmisch zusammenziehen und wieder ausstrecken.
Bei genauerem Hinsehen entdeckt man im Inneren der masslos auseinandergetriebenen Fühler je einen dicken, braun oder grün geringelten, länglichen Sack, dessen anderes Ende unter der Schneckenschale verborgen bleibt. Die Vermutung liegt auf der Hand, dass diese Schnecken von ganz besonderen Parasiten befallen sein müssen. Es ist eine Zwischenform des sonst im Darm von Vögeln lebenden Saugwurms Leucochloridium macrostomum. Parasiten brauchen normalerweise einen Wirt, auf dessen Kosten sie leben. Der Saugwurm Leucochloridium hat aber deren zwei, den Hauptwirt, einen Singvogel, und den Zwischenwirt, die Bernsteinschnecke. Der Wirtswechsel richtet sich nach einem Fahrplan:
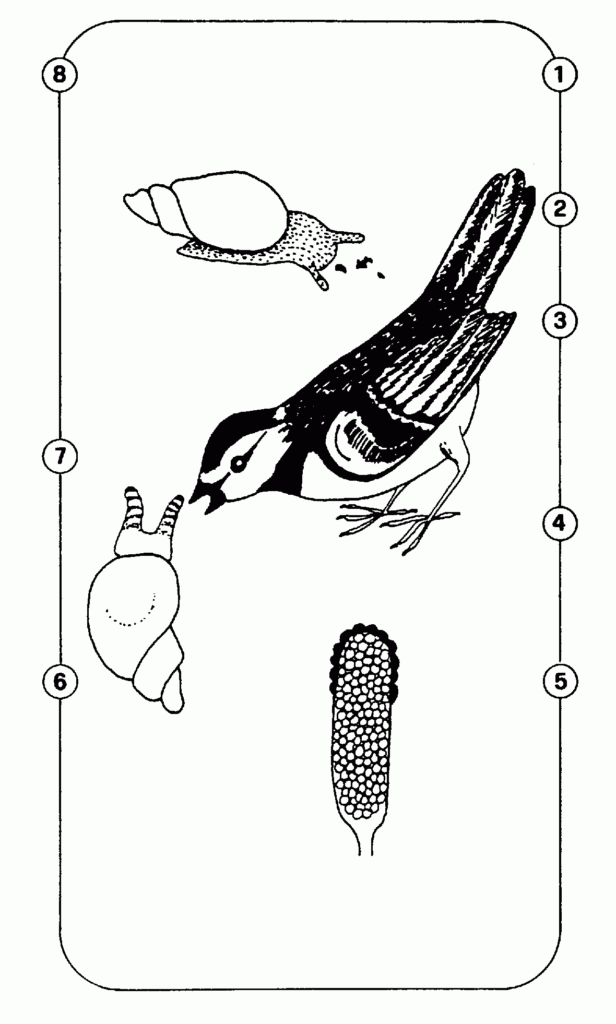
- Vögel, die mit Saugwürmern befallen sind, scheiden mit ihrem Kot auch massenweise Eier dieser Darmparasiten aus.
- Fällt Kot von den auf Bäumen oder Sträuchern sitzenden Vögeln auf Pflanzen, die darunter wachsen, und leben auf diesen Bernsteinschnecken, so sehen wir bald, wie sie ihn auffressen. Ohne es zu merken, nehmen sie auch die darin enthaltenen Saugwurmeier auf.
- Erst der Darmsaft der Schnecken löst die Wurmschalen auf. Die frei gewordenen, winzig kleinen Frühlarven oder Miracidien durchbohren die Darmwand und wandern in die Leber.
- In der Leber verwandeln sich die Larven in kapselförmige, unbewegliche Gebilde, in sogenannte Sporocysten. Diese verzweigen sich und bilden ein dichtes Wurzelgewebe, das alle inneren Organe der Schnecke umspinnt.
- Die sackförmigen Sporocysten wachsen und werden schliesslich 1 cm lang. In ihnen entwickeln sich viele Tochterkapseln, aus denen wieder bewegliche Spätlarven oder Cercarien entstehen.
- Die wurstförmigen Sporocysten liegen wie Torpedos im Schneckenkörper. Zwei von ihnen drücken in die Fühler, weiten sie aus und pulsieren in diesen 40–70mal in der Minute hin und her. Sie sind auffallend grün oder gelb-braun geringelt.
- Die sonst lichtscheuen Bernsteinschnecken kriechen, wenn sie so befallen sind, gern ins Helle. Hier findet sie ein Singvogel leicht, der die sehr auffälligen Fühler für Raupen oder etwas Ähnliches hält, sie abbeisst und frisst oder an seine Jungen im Nest verfüttert.
- Die mit einer dicken Haut umgebenen Cercarien gelangen in den Darm der Vögel und entwickeln sich dort zu geschlechtsreifen, zwittrigen Saugwürmern, die schliesslich wieder grosse Mengen von Eiern abgeben.
Wenn die Vögel den infizierten Kot auf die von Bernsteinschnecken besiedelten niederen Pflanzen fallen lassen, schliesst sich der Entwicklungskreis. Er kann ein ganzes Jahr dauern. Die Saugwürmer schaden den Vögeln kaum jemals gefährlich, befallene Bernsteinschnecken gehen aber meistens daran zugrunde.
Parasitierte Bernsteinschnecken winken mit den Fühlern
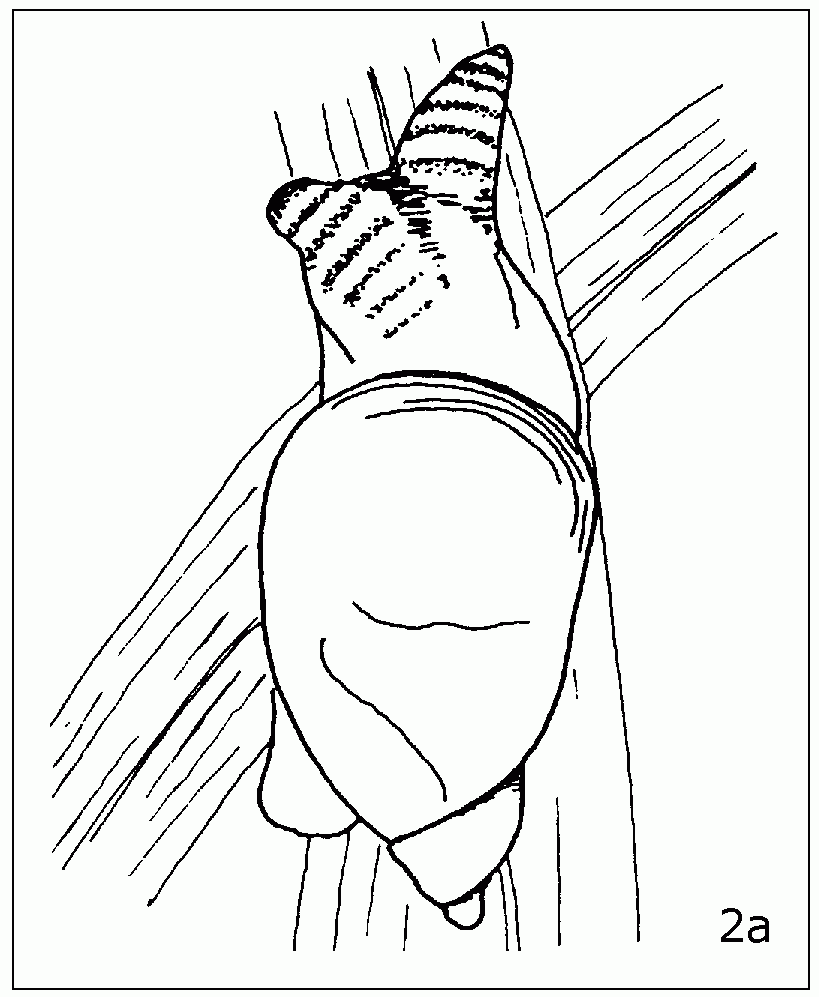
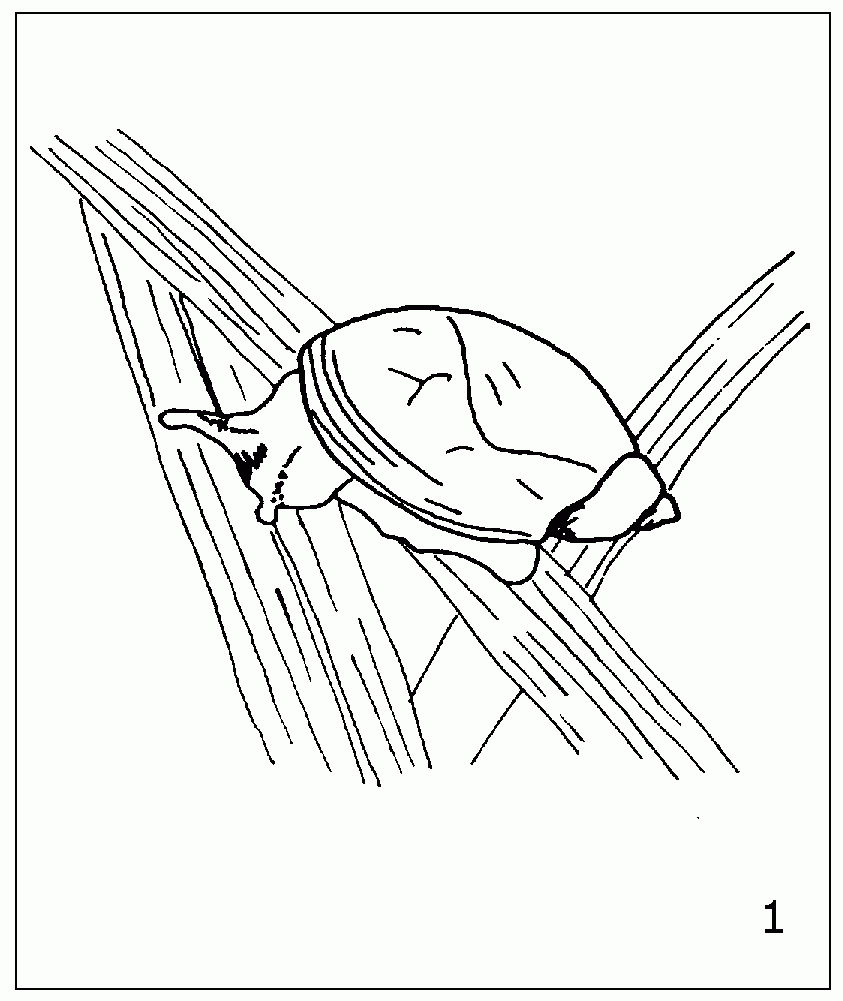
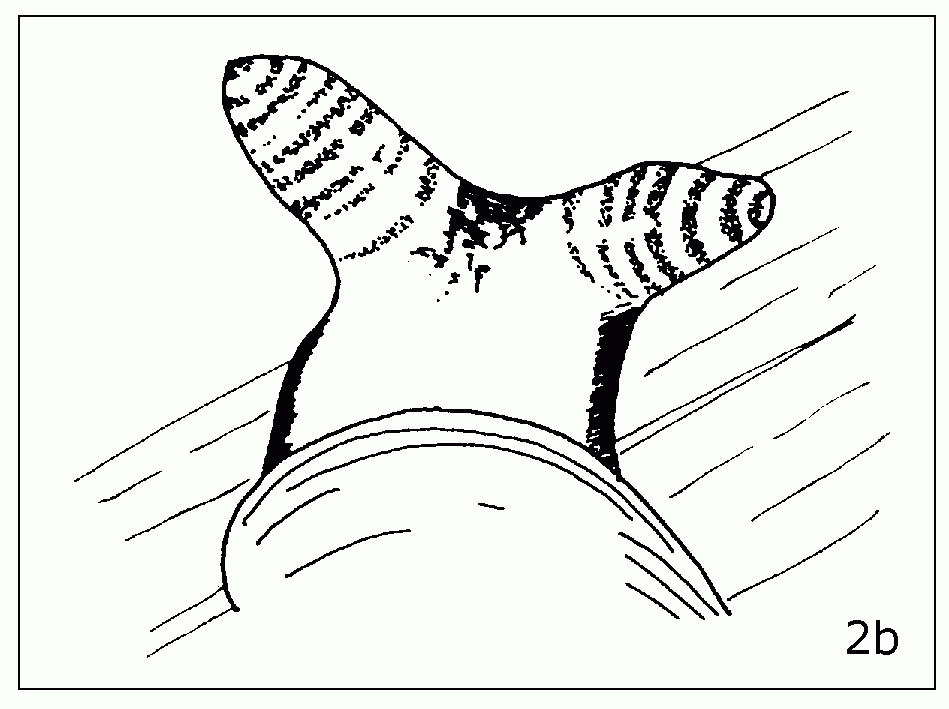
Entwicklungszyklus des Saugwurms Leucochloridium macrostomum, der Bernsteinschnecken und Singvögel parasitiert
- Singvögel scheiden mit ihrem Kot Saugwurmeier aus.
- Bernsteinschnecken fressen Vogelkot samt Saugwurmeiern.
- Im Darm der Bernsteinschnecken schlüpfen die Larven der Saugwürmer aus den Eiern und wandern in die Leber.
- Die Larven verwandeln sich in sackförmige Gebilde, in Sporocysten.
- Aus den sackförmigen Gebilden entwickeln sich Tochtersporocysten.
- Einige der grossen Säcke dringen in die Fühler der Schnecke und bewegen sich darin hin und her. Aus den Tochtersporocysten entstehen Stadien, die wieder beweglich sind. Man nennt sie Cercarien.
- Ein Vogel pickt die Schneckenfühler ab und infiziert sich mit den Cercarien.
- Im Enddarm des Vogels verwandeln sich die Cercarien in geschlechtsreife Saugwürmer. Diese produzieren grosse Mengen von Eiern.
Spinnen



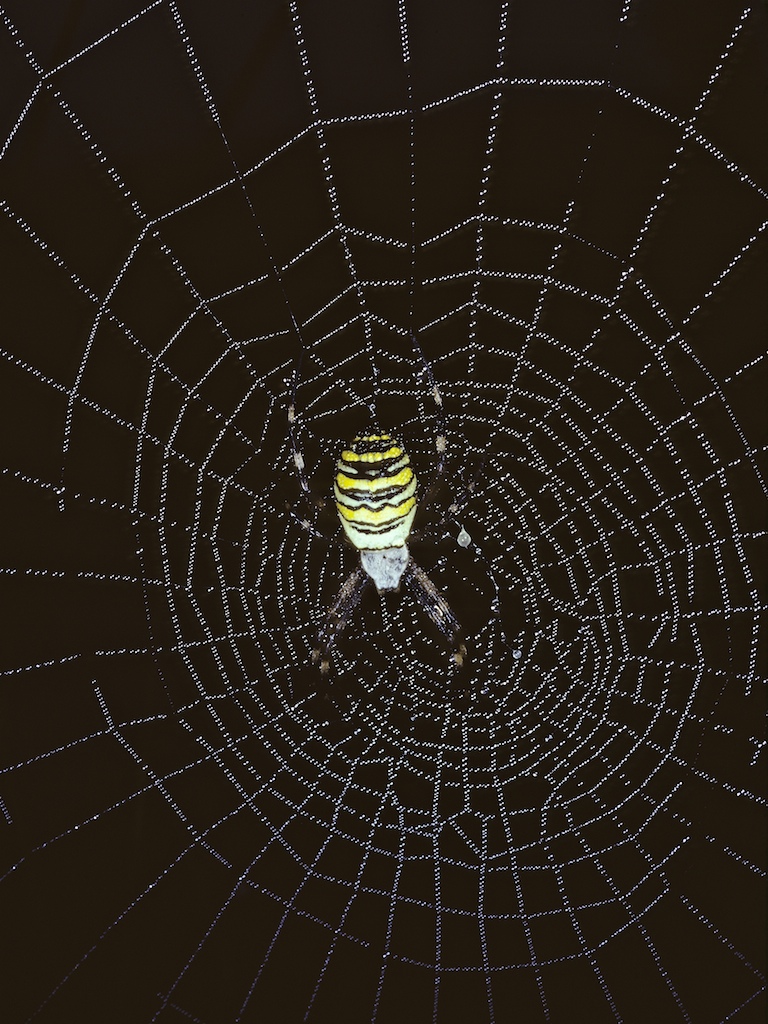









































Die Kreuzspinne oder ein Leben am seidenen Faden
Körperbau
Kreuzspinnen lassen sich gut betrachten und beobachten, wenn man sich ihnen ruhig nähert und ihr Netz nicht erschüttert. Sie haben die Gewohnheit, kopfunter in der Mitte ihres Netzes, der enggesponnenen Nabe, auf Beute zu lauern, darum entdecken wir sie auch eher als viele andere Spinnen. Am ehesten suchen wir ihr Netz am frühen Morgen, wenn die funkelnden Tau-tropfen die Fäden weithin sichtbar machen. Wir finden sie in den Monaten Juli bis Oktober in Gärten, an Waldrändern und auf Ödländereien mit Gebüschen und höheren Blütenpflanzen.
Eine helle, kreuzförmige Zeichnung leuchtet auf dem rundlichen, gelbbraun gefleckten Hinterleib. Er ist nicht gegliedert wie derjenige der Insekten. Kopf und Brust sind zu einem kleineren Kopfbruststück verwachsen. Es trägt 6 Gliedmassenpaare: 2 Paar Mundwerkzeuge, d.h. die zweigliedrigen Klauenkiefer und die beinartigen Kiefertaster, sowie 4 Paare Beine. Wie alle Spinnentiere besitzt auch die Kreuzspinne keine Fühler. Sie sieht auch nicht gut mit ihren 8 Punktaugen, die in zwei Reihen angeordnet sind.
Der Hinterleib zeigt auf der Bauchseite vorne 2 schlitzförmige Öffnungen, die Lungenstigmen. Sie führen in die Atmungsorgane, die bei den Spinnen Fächertracheen oder Fächerlunge heissen. Es ist eine taschenförmige Atemhöhle, in der zarte Blattlamellen hängen. Diese werden von Blut durchströmt, und an den dünnen Wänden findet der Übertritt des Luftsauerstoffes statt. Neben den Fächertracheen besitzen die Spinnen Röhrentracheen, die denen der Insekten gleichen. Das unpaare Tracheenstigma liegt vor den Spinnwarzen.
Spinnapparat
Der dicke Hinterleib ist angefüllt mit verschiedenen Spinndrüsen. Sie münden hinten unten in 6 kegelförmige, bewegliche Spinnwarzen. Aus diesen tritt durch eine Platte mit Spinndüsen – pro Platte sind es deren 100 – die Spinnflüssigkeit. Je nach Bedarf kann die Kreuzspinne starre oder elastische, dicke oder dünne, trockene oder klebrige Fäden aus den verschiedenen Drüsenarten treten lassen.
Die einzelnen Fäden sind etwa 0.004 mm dick, erstarren sofort an der Luft und werden je nach der gewünschten Verwendung von den Spinnwarzen direkt auf die Unterlage aufgeklebt, von den Endgliedern der Hinterbeine als breites Band weggezogen oder zu einem dickeren Tau vereinigt, das die Spinne durch die Webklauen eines Fusses gleiten lässt. Spinnfäden haben eine erstaunliche Tragfähigkeit und sind zudem sehr elastisch. Könnte man aus lauter Fangfäden ein 2.5 cm dickes Seil zusammendrehen, so würde es mit Sicherheit ein Gewicht von 75 Tonnen tragen. Jedes noch so gute Stahlseil mit gleichem Durchmesser würde dabei zerreissen. Noch keiner Fabrik ist es gelungen, einen so zähen und dehnbaren, dünnen und doch widerstandsfähigen Faden herzustellen.
Netzbau
Mit etwas Glück kann man in der freien Natur den Bau eines Radnetzes beobachten. Sehr viele Spinnen sind Nachttiere und beginnen mit dieser Arbeit meistens in den späteren Abendstunden. Bei mir zu Hause kann ich ihnen jedes Jahr zusehen, wenn sie kurz vor Sonnenuntergang in den Blumenkisten meines Balkons dieser Tätigkeit obliegen. Im September sperre ich bisweilen auch eine ausgewachsene Kreuz- oder Zebraspinne in einen Raupenzuchtkasten, den ich dann in die Zugluft stelle, um günstige Voraussetzungen für den Netzbau zu schaffen.
Von einem erhöhten Sitzplatz aus presst die Radnetzspinne einen klebrigen Spinnfaden aus und wartet, bis dieser vom Wind erfasst und fortgetragen wird. Wenn er irgendwo haften bleibt, prüft sie durch Zupfen, ob er hält. Dann bewegt sie sich recht riskant über die Brücke, indem sie vor sich her den ersten Faden wieder auffrisst und hinter sich einen neuen, trockenen und stärkeren spinnt. Hat die Brücke die gewünschte Länge und Festigkeit, so seilt sie sich in der Mitte des Fadens ab, bis sie einen Zweig oder den Boden erreicht und verankert dieses Tau sehr gut an der Unterlage. So entsteht eine y-förmige Figur.
Um die drei ersten Speichen baut sie nun den Rahmen und fügt vom Mittelpunkt aus weitere Speichen ein. Enge Spiralen im Mittelpunkt des Netzes bilden die Warte, auf der sich die Spinne später öfter aufhalten wird. Es folgt nach aussen hin eine weite Hilfsspirale, die dem Tier beim Endausbau des Netzes dienlich ist. Erst danach baut sie die eigentlichen Fangfäden in das vorbereitete Gerüst ein. Waren bis jetzt alle Spinnfäden trocken und glatt, so spinnt das Tier zum Abschluss von aussen her nach innen mit einem klebrigen Faden die Fangspirale und frisst dabei gleichzeitig die nun überflüssige Hilfsspirale auf. Der Fangfaden besteht aus zweierlei Material, aus dem tragenden Tau und aus einem klebrigen Mantel. Die Spinne klebt ihn an jeder Speiche fest und zupft dann kurz mit einem Bein daran. Der elastische Tragfaden gibt nach, der Klebstoff zerreisst, und es bilden sich in regelmässigen Abständen lauter kleine Tröpfchen.
Der Netzbau ist eine angeborene Instinkthandlung, verläuft immer in ähnlicher Art und ist nach etwa einer halben Stunde fertig. Die Kreuzspinne überwacht anschliessend ihr Netz entweder vom Zentrum oder von einem ausserhalb des Netzes liegenden Schlupfwinkel aus. Im zweiten Fall bleibt sie mit ihrem Netz durch einen trockenen Signalfaden verbunden. Damit die Spinne beim Herumklettern auf dem Netz nicht selbst Opfer ihrer Klebfalle wird, ist ihr Körper mit einem Ölfilm überzogen.
Spinnen sind gefrässige Tiere
Im Netz hat sich eine Fliege verfangen; je mehr sie darin zappelt, desto stärker verwickelt sie sich in den klebrigen Fangfäden. Durch die Erschütterungen des Netzes wird die Spinne alarmiert. Blitzschnell ist sie bei ihrem Opfer und lähmt es durch einen Biss mit den Klauenkiefern. Aus den taschenmesserartig herausgeklappten Klauen fliesst das lähmende Gift in den Körper der Fliege.
Vielfach wickeln die Radnetzspinnen ihre Beute nach dem Biss vorerst ein. Dazu befestigen sie mit je einem Faden den Kopf und das Hinterende des Opfers am Netz und beissen alle anderen Taue, in die sich das Insekt verfangen hat, ab. Die Beute lässt sich nun wie ein Poulet am Bratspiess frei um die Längsachse drehen, und aus den vielen feinen Düsen der Spinnwarzen schiessen viele Dutzend hauchzarter Fäden, die mit einem Hinterbein als mehrere Millimeter breites, klebriges Band um das Opfer gesponnen werden.
Wenn die Spinne ihr Opfer verzehren will, träufelt sie mit den Klauenkiefern einen Verdauungssaft in die Beute, der die weichen Innenteile auflöst. Anschliessend saugt sie die vorverdaute Nahrung durch eine schmale Mundspalte ein. Es findet also eine Aussenverdauung statt. Die leeren Chitinhüllen bleiben zunächst im Netz hängen, später werden sie von der Spinne herausgetrennt. Beschädigte Netze bessert die Spinne in kurzer Zeit wieder aus.
Spinnenweibchen von unten und im Längsschnitt
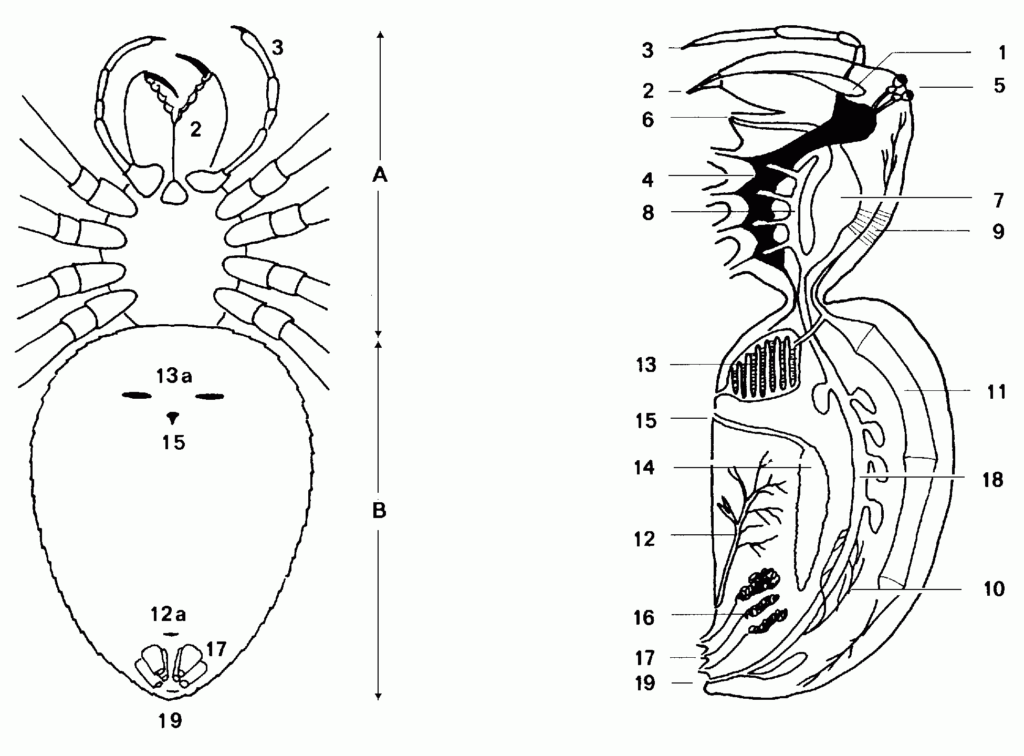
Bildlegende
- Giftdrüse mit Giftkanal in der Kieferklaue
- Zweigliedrige Kieferklaue für den Biss und die Giftinjektion
- Beinartige Kiefertaster (bei den Männchen dienen die Endglieder als Überträgerorgane für die Samenzellen)
- Zentralnervensystem
- 8 einfache Linsenaugen
- Mundöffnung
- Saugmagen
- Blindsäcke
- Muskulatur für die Betätigung des Magens
- Ausscheidungsorgane (Nieren)
- Herzrohr mit nach vorne und nach hinten führenden Arterien
- Röhrentracheena. Stigma der Röhrentracheen
- Fächertracheen («Buchlunge»)a. Stigmen der Fächertracheen
- Eierstock
- Geschlechtsöffnung (liegt auch bei Männchen an dieser Stelle)
- Spinndrüsen
- 3 Paare Spinnwarzen
- Darm mit Blindsäcken
- After
Spinnorgane und Beutefang
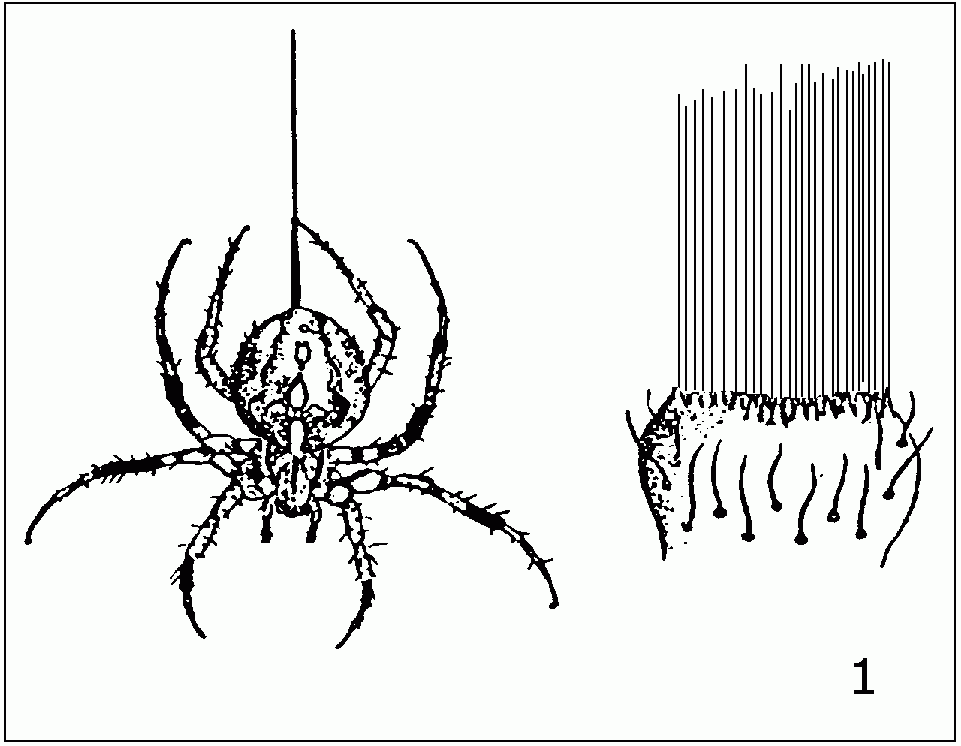
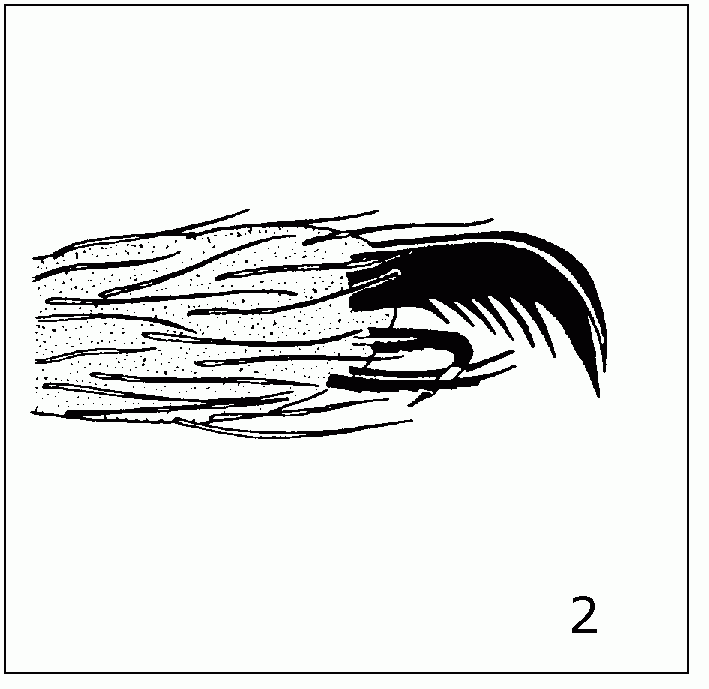
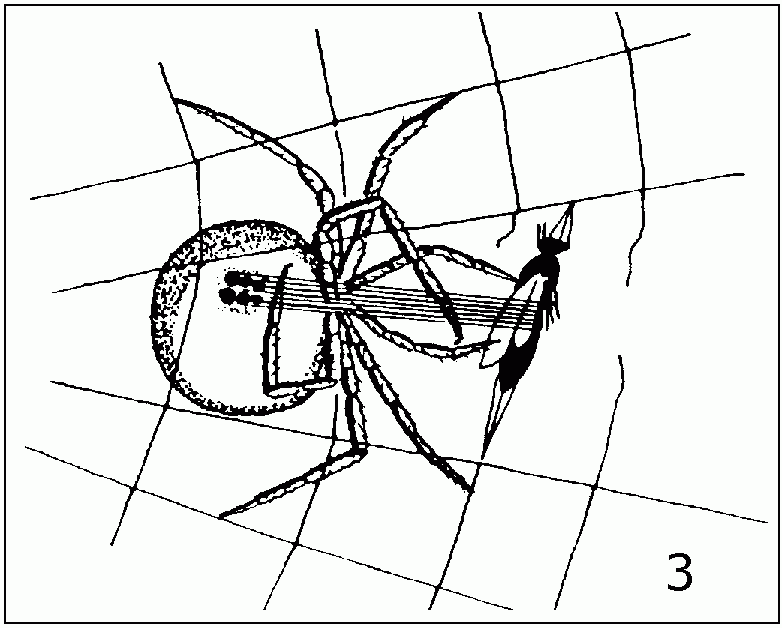
- Spinnapparat: Im Hinterleib liegen zahlreiche Drüsen, die verschiedenartige Spinnflüssigkeiten produzieren. Jede Drüse mündet in eine der 6 kegelförmigen Spinnwarzen, die je etwa 100 Spinnspulen besitzen, durch die einzelne Seidenfäden von 0.001mm- 0.004 mm Dicke austreten.
- Hinterbein mit Häkchen- und Kammkrallen: Will die Kreuzspinne ein Netz bauen, so lässt sie das Fadenbündel durch das Krallensystem eines Hinterfusses gleiten. So kann sie die einzelnen Fäden zu einem tragfähigen «Seil» vereinigen.
- Einwickeln eines Opfers: Wenn sich Fliegen und andere harmlose Opfer im Netz verfangen, so tötet sie die Spinne zuerst mit einem Biss ihrer Kieferklauen und wickelt sie dann meistens mit Seidenbändern ein. Gefährliche Beutetiere wie Honigbienen und Wespen wickelt sie zuerst ein, bevor sie den Giftbiss anbringt.
Die Kreuzspinne baut ein Netz I
- Die Kreuzspinne baut ihr Netz entweder in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden und braucht dazu etwa 30 Minuten. Zuerst lässt sie einen Faden austreten, der durch den Luftzug verfrachtet wird und irgendwo hängenbleibt. Hält dieser erste Horizontalfaden, so bewegt sich die Spinne sehr riskant über diese Brücke, indem sie den ersten Faden bis zur Mitte wieder auffrisst und hinter sich her einen neuen spinnt.
- In der Mitte verknüpft sie die beiden Fäden und lässt sich dann an einem weiteren Faden langsam fallen, bis sie auf eine Unterlage trifft, wo sie den senkrechten Ast des Y-Grundgerüstes festheftet.
- Um das Grundgerüst der ersten drei Speichenfäden entstehen die ersten Rahmenfäden.

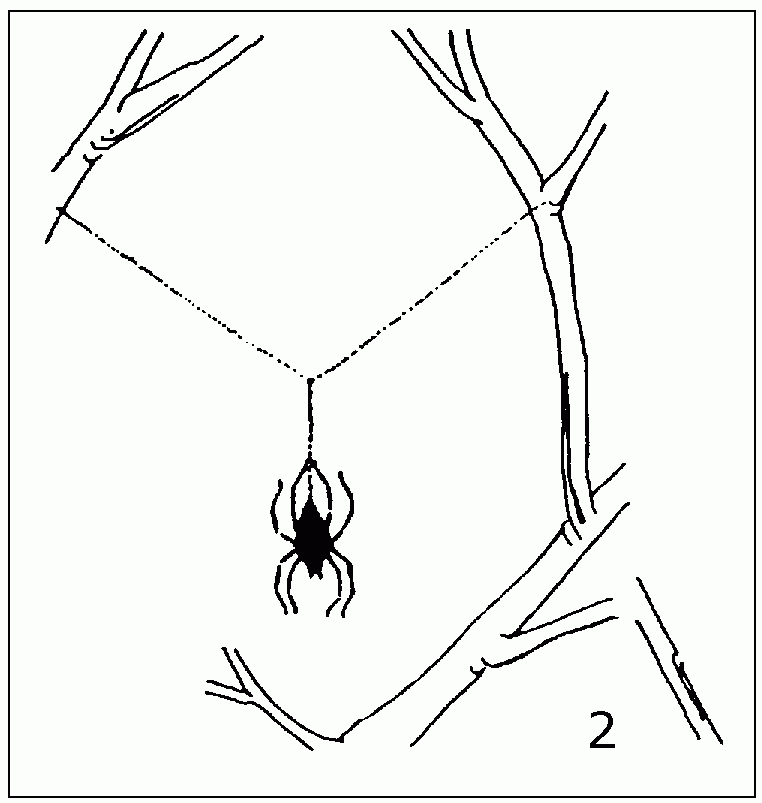
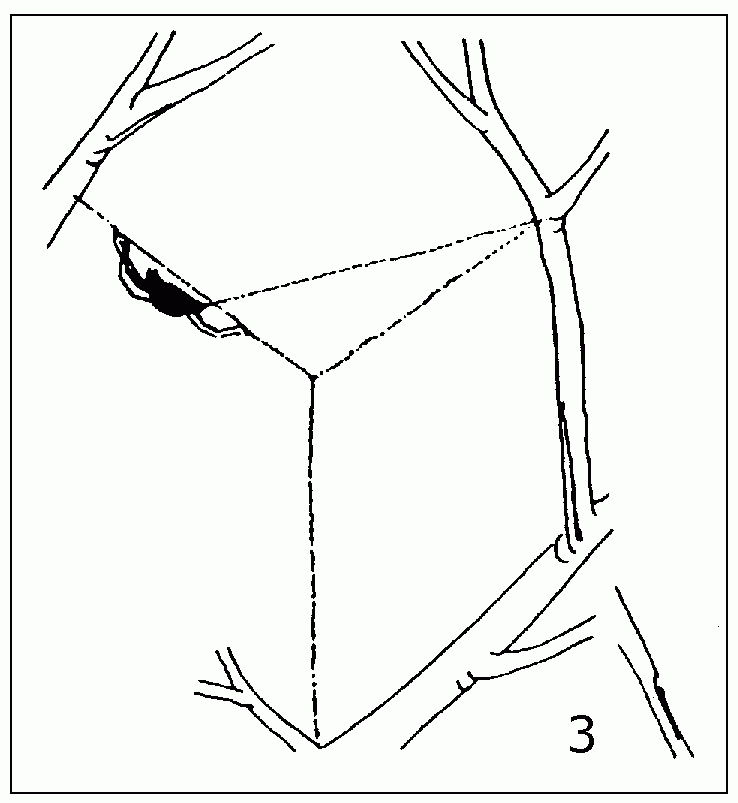
Die Kreuzspinne baut ein Netz II
- Vom Zentrum aus zieht die Spinne nach verschiedenen Richtungen weitere Speichenfäden ein und erweitert im gleichen Arbeitsgang auch den Rahmen.
- Noch während des Speichenziehens verbindet die Spinne durch kreisförmige Umgänge im Netzzentrum die einzelnen Speichen durch eng aneinandergerückte Spiralfäden. Das Netz besteht dann aus den 20–30 erstaunlich regelmässig angeordneten Speichen, dem äusseren Rahmen und der inneren Befestigungszone.
- Es folgt von innen nach aussen hin eine weite Hilfsspirale, die dem Tier beim Endausbau des Netzes dienlich ist. Sie wird lediglich als Klettergerüst zum Bau der Fangspirale benützt. Wenn die Hilfsspirale fertig ist, legt die Spinne eine kleine Pause ein und geht dann zur letzten Bauphase über.
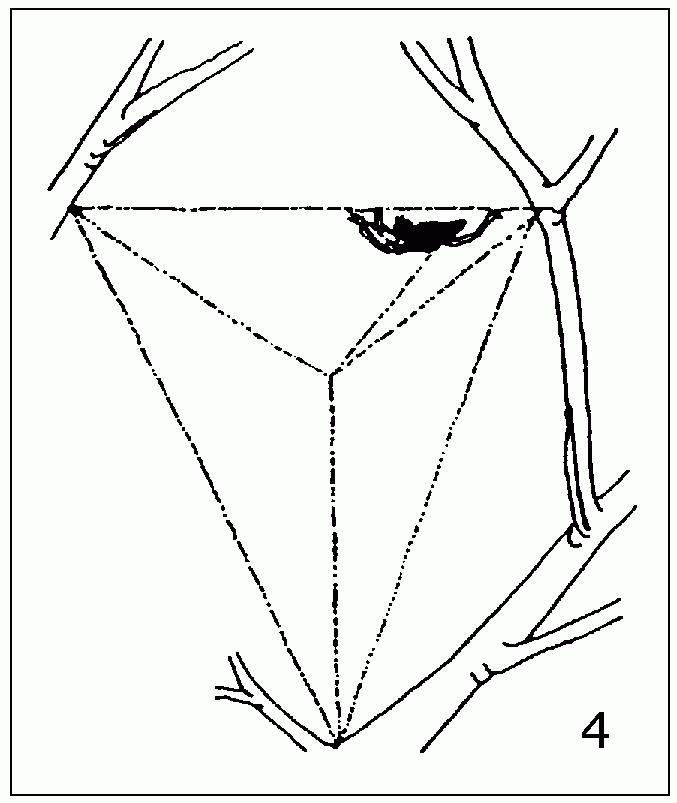
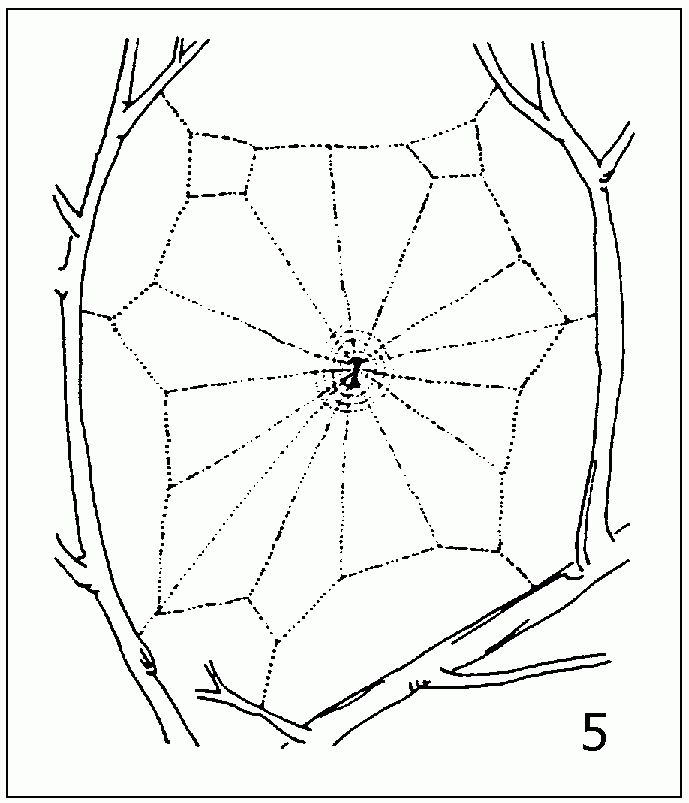
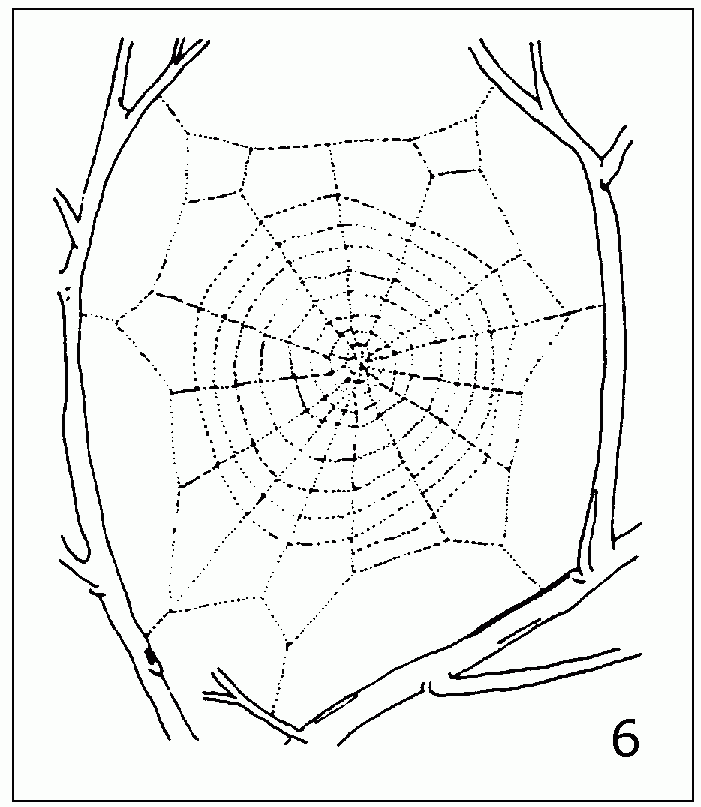
Die Kreuzspinne spinnt ein Netz III
- Die Spinne zieht die klebrige Fangspirale von aussen nach innen ein. Beim Überqueren einer Speiche heftet sie den Klebfaden an. Die überflüssig werdende Hilfsspirale frisst sie dabei allmählich auf. Der Fangfaden ist perlschnurartig mit Leimtröpfchen besetzt. Er verläuft nicht regelmässig, sondern ändert an vielen «Umkehrpunkten» seinen Laufsinn, besonders im unteren Netzteil, wo bedeutend mehr Umgänge liegen als im oberen. Darum ist auch das Zentrum nach oben verschoben.
- Für das Einziehen der Fangspirale braucht die Spinne etwa 20 Minuten, während die Rahmen-, Speichen- und Hilfsspiralenkonstruktion in 5 Minuten ablaufen kann. Die Länge aller Fäden misst etwa 20 m, das Gewicht höchstens 0.005 g.Nach der Arbeit sitzt die Spinne entweder auf der Nabe oder, verbunden mit einem Signalfaden, ausserhalb des Netzes in einem Schlupfwinkel.
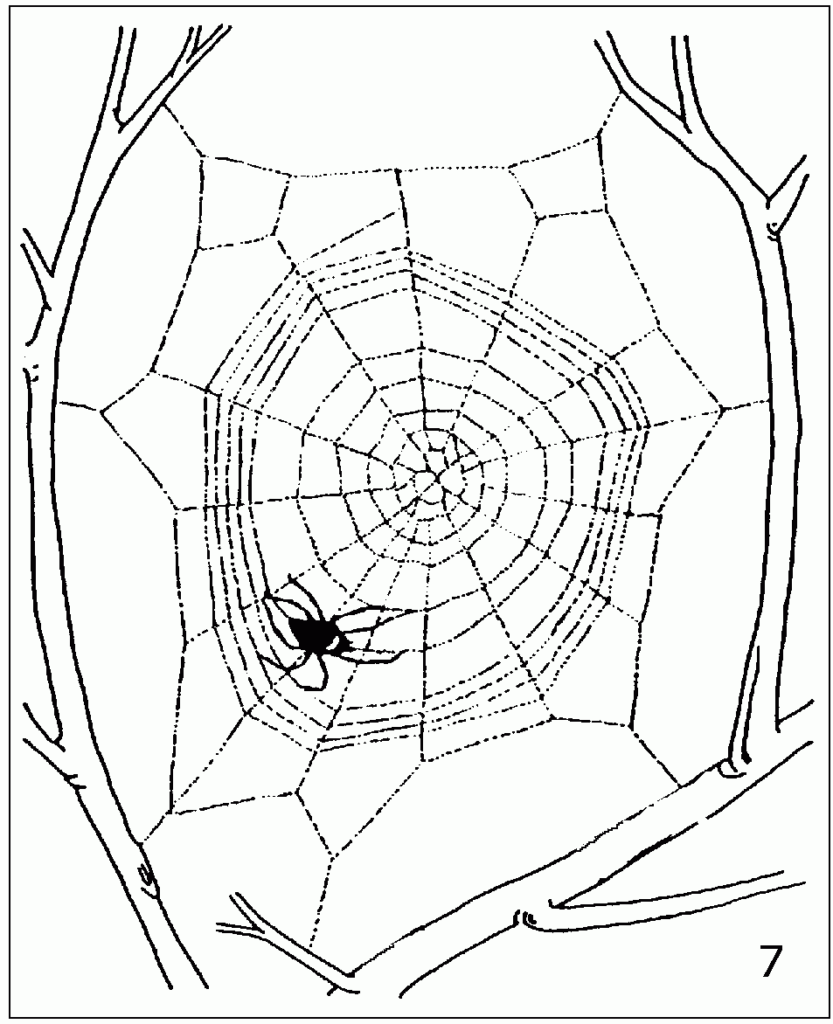
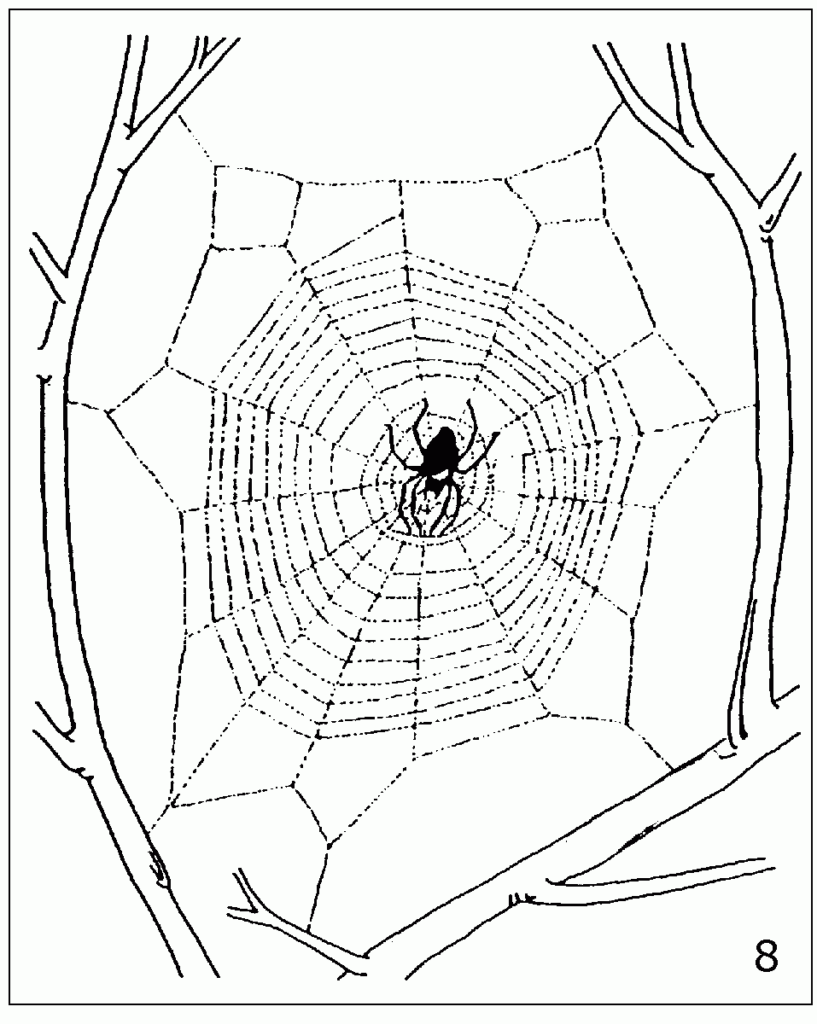
Zebraspinne
Aus dem Leben der Zebraspinne: Auf weichen Daunen lässt sich sorglos schlafen
Fangnetz
Wenn wir im Sommer und in den ersten Herbstmonaten durch stark besonnte Magerwiesen streifen, deren Gras nicht geschnitten wird, oder auf überwachsenen Ödplätzen nach allerlei kleinen Tieren Ausschau halten, werden wir nicht selten auf sonderbare Spinnennetze aufmerksam. Ihr Zentrum, die sogenannte Nabe, glitzert weiss, und in der Mitte entdecken wir ein starkes Zickzackband, welches das Netz von oben nach unten durchmisst. Meistens sehen wir auch sogleich die Besitzerin der kunstvoll gesponnenen Falle, die grosse, schwarz und gelb quergestreifte Zebraspinne. Sie trägt zu Recht den Titel der Schönheitskönigin unter den Radnetzspinnen. Geduldig wartet sie auf Besucher im Labyrinth ihrer Fäden, und kaum sind sich diese der hoffnungslosen Lage bewusst, werden sie von der Spinne gepackt, tödlich gebissen und anschliessend sorgfältig eingewickelt. Zu den Opfern, deren Körpersäfte sie aussaugt, gehören neben Fliegen, Mücken und zahlreichen kleinen Schmetterlingen auch junge Heuschrecken, selten aber Bienen und Wespen.
Brutfürsorge
Im August und September – das sind die letzten Monate ihres Lebens – verlässt die Spinne etwa sechsmal ihr Netz für zwei Tage, um für ihre Nachkommen zu sorgen. In der Nähe des Fanggewebes beginnt sie in den Abendstunden, oft aber auch erst nach Einbruch der Dunkelheit, Halme auf halber Höhe durch fast waagrecht gezogene Fäden zu verbinden. Nach und nach entsteht ein unregelmässiges Netzgerüst, ein Baugespann für das
eigentliche Jugendhaus. Im Zentrum webt die nun in Rückenlage hängende Spinne eine Platte, so gross wie ein Quadratzentimeter. Es ist die Decke für das später entstehende Gewölbe, das der Aufnahme der Eikugel dient. Die Mutter presst jetzt einen stets grösser werdenden, hellgelben Flüssigkeitstropfen hervor, in welchem bald die ersten orangen Eier zu erkennen sind. Ruckartig drückt die Spinne ein stecknadelgrosses Eipaket ums andere an die Decke des Gewölbes. Wenn nach rund zwei Minuten das kugelförmige Gebilde etwa 400 Eier enthält, wird es sogleich mit einer dünnen Lage weisser Fäden umsponnen, die bald zu einer pergamentartigen, dichten Hülle erstarren. Auf diese innere Eiballenhülle folgt in gut einstündiger Arbeit eine dicke Packung lockerer, in sich verschlungener, dunkelbrauner Fadenwatte. Kein noch so guter Schlafsack enthält eine derart vollkommene Isolierschicht. Schliesslich umhüllt die besorgte Mutter die ganze zukünftige Kinderstube mit einem letzten äusseren Gespinst, dessen Fäden so eng beieinander liegen, dass selbst feinste Wassertropfen nicht eindringen können. Damit auch der Wind dem birnenförmigen Kokon keinen Schaden zufügen kann, befestigt sie das Haus ihrer Nachkommen noch mit zahlreichen, straff gespannten Fäden zwischen benachbarten Pflanzenteilen. Noch einen Tag lang finden wir die Spinnenmutter wachend in der unmittelbaren Nähe des Kokons, dann aber kehrt sie zu ihrem Fanggewebe zurück. Sie braucht neue Nährstoffe für den Bau der nächsten Kinderstube.
Die Jungspinnen überwintern im Schlafsack
Rund einen Monat nach dem Kokonbau schlüpfen die Jungspinnen aus ihren Eiern, und zwar in Schüben, die sich über zwei Wochen hinziehen können. Die innerste Hülle, der fast kugelförmige Eisack, springt zeitlich genau angepasst von selbst auf, und die kleinen Spinnen streben hinaus in die warme Fadenwattenschicht. Darin verschlafen sie den ganzen Winter, bestens geschützt vor Kälte, Nässe und Wind. Nahrung benötigen sie noch keine, denn die vorsorgende Mutter hat jedem Ei einen genügend grossen Vorrat mitgegeben.
Die Jungspinnen brechen aus
Nach der Überwinterung beginnt in den letzten Maitagen ein weiterer Abschnitt im Leben der Zebraspinnen. Die birnenförmige Aussenhaut des Kokons platzt durch die Einwirkung der Sonne. Die in Scharen herausströmenden, munteren Spinnenkinder klettern an den Grashalmen empor, produzieren aus ihren Spinndrüsen mehrere Meter lange Fäden und lassen sich mit Hilfe dieser feinen Seidensegel durch die Lüfte tragen. So verteilen sich die Nachkommen im weiten Umkreis, bauen dann ihre ersten kleinen Netze dicht über dem Boden, und die Weibchen unter ihnen geben bereits drei Monate später das Leben an die nächste Generation weiter.
Hinweise für die Beobachtung
Zebraspinnen findet man seit ungefähr 1980 recht zahlreich auf nicht bewirtschafteten Wiesenstücken und Ruderalflächen. Etwa ab August sind sie ausgewachsen und mit ihren Körperlängen von 15–20 mm recht auffällig. Auch ihre grossen, gut 50 cm über dem Boden angelegten Netze mit dem etwa 1 cm breiten Zickzackband sind kaum zu übersehen.
Wenn man den Netzbau, vor allem aber den Bau eines Eikokons beobachten will, sperrt man ein kräftiges Weibchen in einen Raupenzuchtkasten und stellt diesen an die Zugluft, beispielsweise auf einen Balkon. Als «Turngeräte» für die Spinne haben sich lockere Büschel von kräftigen Grashalmen bewährt, die man in zwei kleinen Erlenmeyerkolben mit etwas Watte verstrebt, damit sie nicht mehr herumrutschen. Ferner wirken zwei bis drei kleinere Heuschrecken irgendwie stimulierend auf die Spinne. Schon nach wenigen Tagen, oft schon nach der ersten Nacht, wird man im Zuchtkasten entweder ein Netz oder den ersten Eikokon vorfinden. Wenn man einen Monat später einen dieser Kokons sorgfältig mit einer spitzen Schere aufschneidet, wird man mehrere hundert winzig kleine, ganz helle Spinnlein vorfinden, die kaum weglaufen. Bevor man sie aussetzt, sollte man den aufgeschnittenen Kokon mit einem schmalen Papierstreifen wieder zukleben.
Aufenthaltsorte und Fangnetz der Zebraspinne
Die grosse, auffällig gelb-schwarz gebänderte Zebraspinne finden wir auf überwachsenen, trockenen Ödplätzen, in Magerwiesen, aber auch auf feuchten Böden. Da sie früher nur im Süden zu Hause war, bevorzugt sie stark besonnte Plätze.
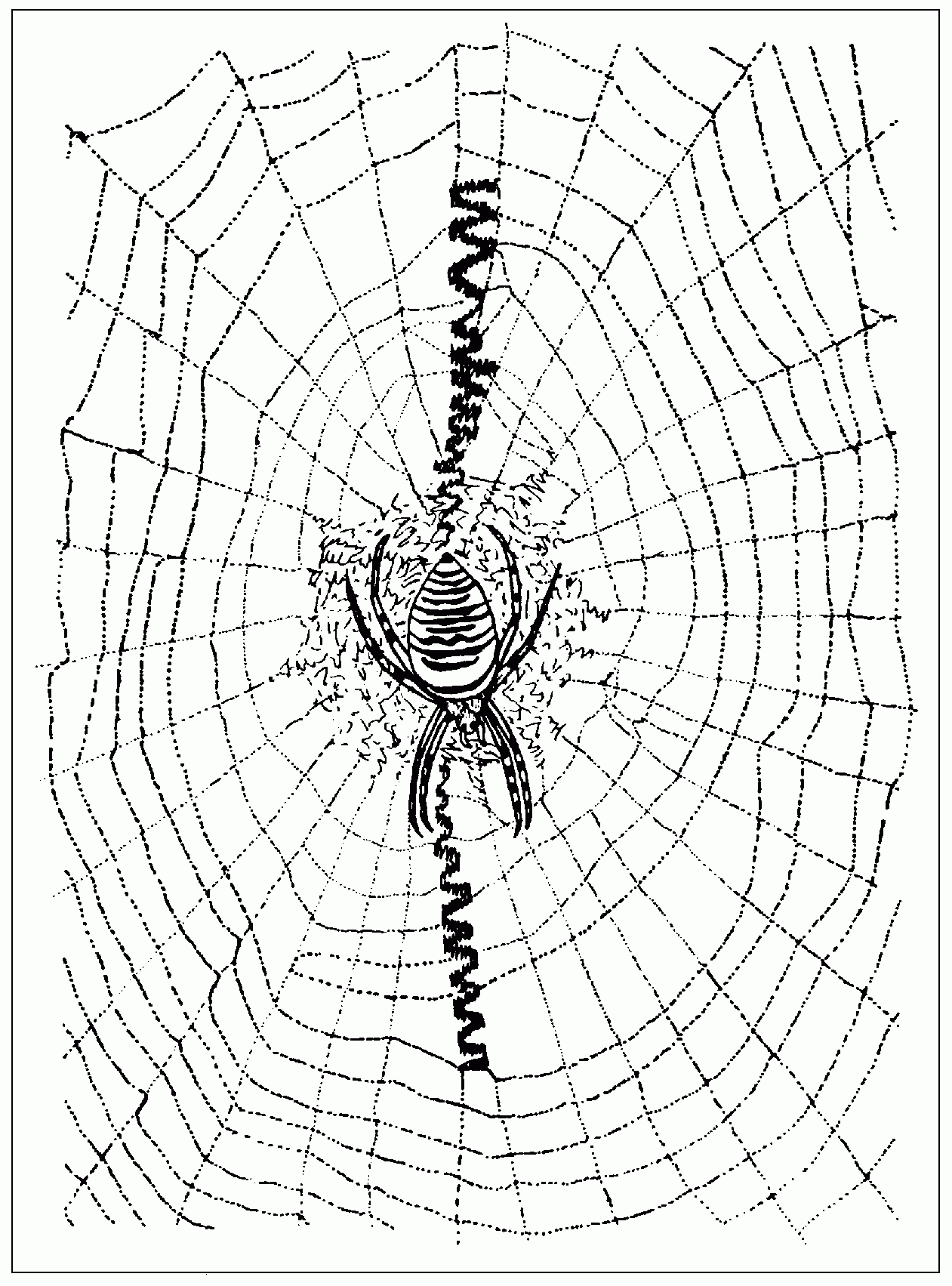
Die Zebraspinne besitzt keinen Schlupfwinkel. Sie hält sich das ganze, nur vom Juli bis September währende Leben auf der Nabe auf und wartet dort kopfunter mit gespreizten Beinen, bis Heuschrecken, Zweiflügler oder Honigbienen ins Netz springen oder fliegen.
Noch auffälliger als sie selbst ist ihr grosses, meist auf Kniehöhe an Grashalmen hängendes Netz von 30 cm Durchmesser. Schon von weitem sehen wir die weiss glänzende Nabe und das eigenartige, breite Zickzackband, welches das Netz von oben nach unten durchmisst und als Stabilisierung dienen soll. Vielleicht hilft es mit, die Spinne optisch aufzulösen.
Die Zebraspinne baut einen Eikokon
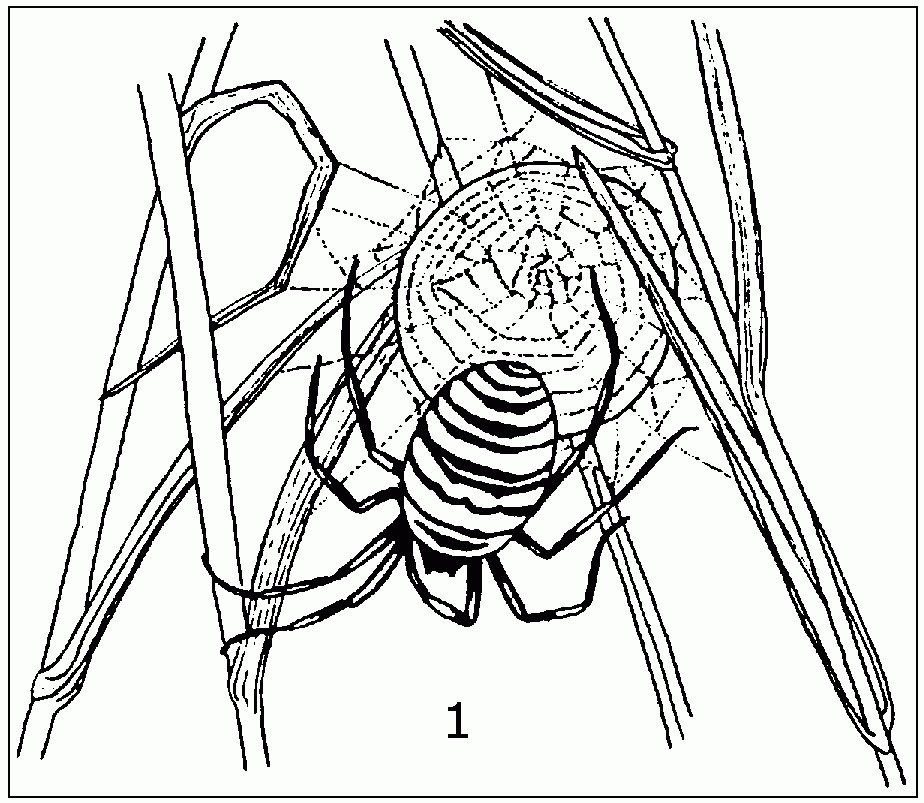
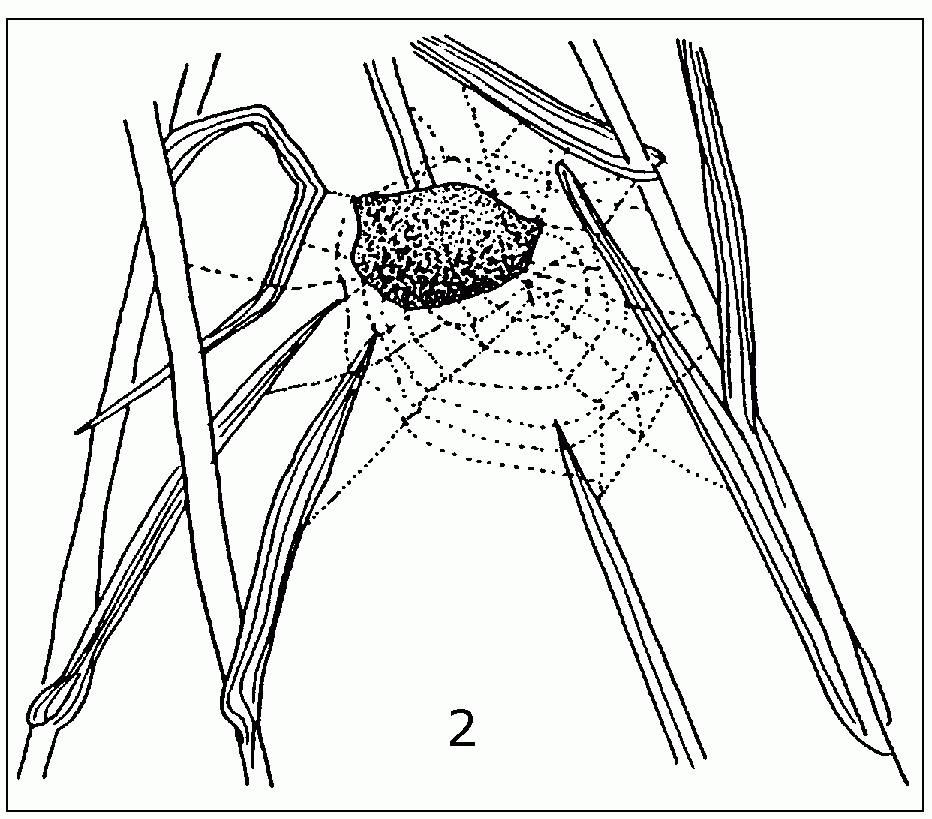
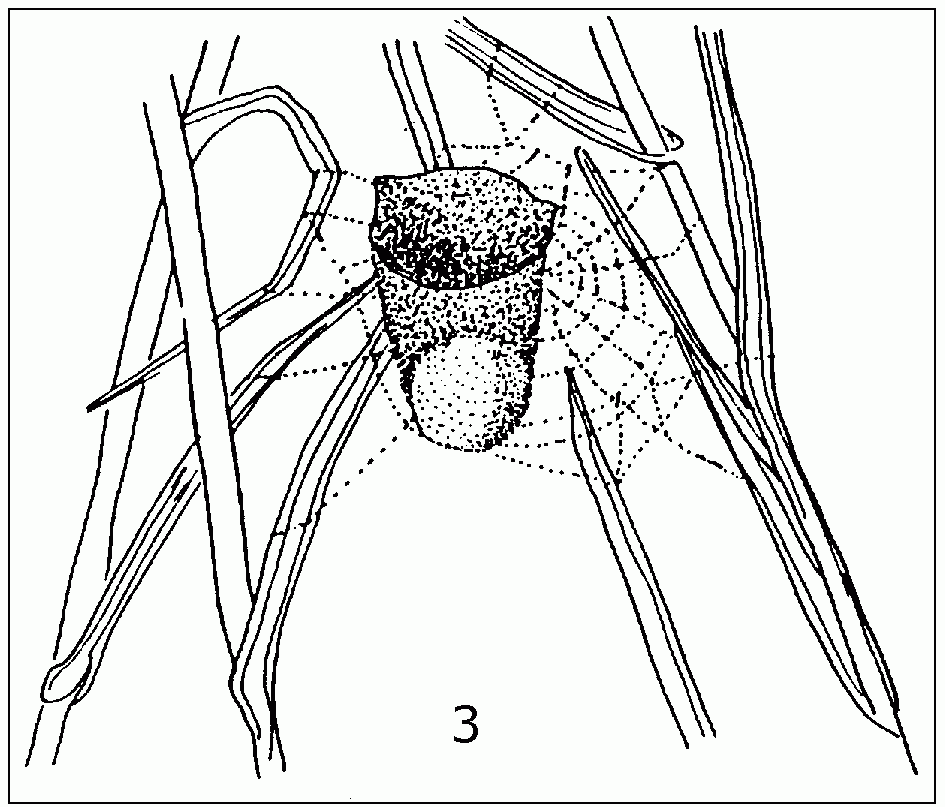
- Baugerüst für einen Eikokon: Im Spätsommer verlässt die Zebraspinne 4–6mal ihr Netz für je 1–2 Tage, um für ihre Nachkommen zu sorgen. In den Abendstunden beginnt sie damit, Halme auf etwa 40 cm Höhe mit einem Fadengerüst zu verbinden. Nach und nach entsteht ein Baugespann für das künftige Jugendhaus.
- Die Decke für den Eikokon entsteht: Im Fadengerüst webt die Spinne eine Platte ein, die wasserdichte Decke für das später entstehende Gewölbe, das der Aufnahme der Eikugel dient.
- Eiablage: Unter der Decke entsteht ein dichtes Gewölbe aus dunkelbraunen, dicht verschlungenen Fäden. Dann presst die darunter hängende Spinne einen stets grösser werdenden, gelben Flüssigkeitstropfen hervor, in dem bald die ersten der schliesslich 400 orangen Eier zu erkennen sind. Nach etwa zwei Minuten ist die Eiablage abgeschlossen, und die Spinne hüllt die Eikugel in einen dichten Sack weisser Fäden.
Fertiger Eikokon von aussen und in Längsschnitten
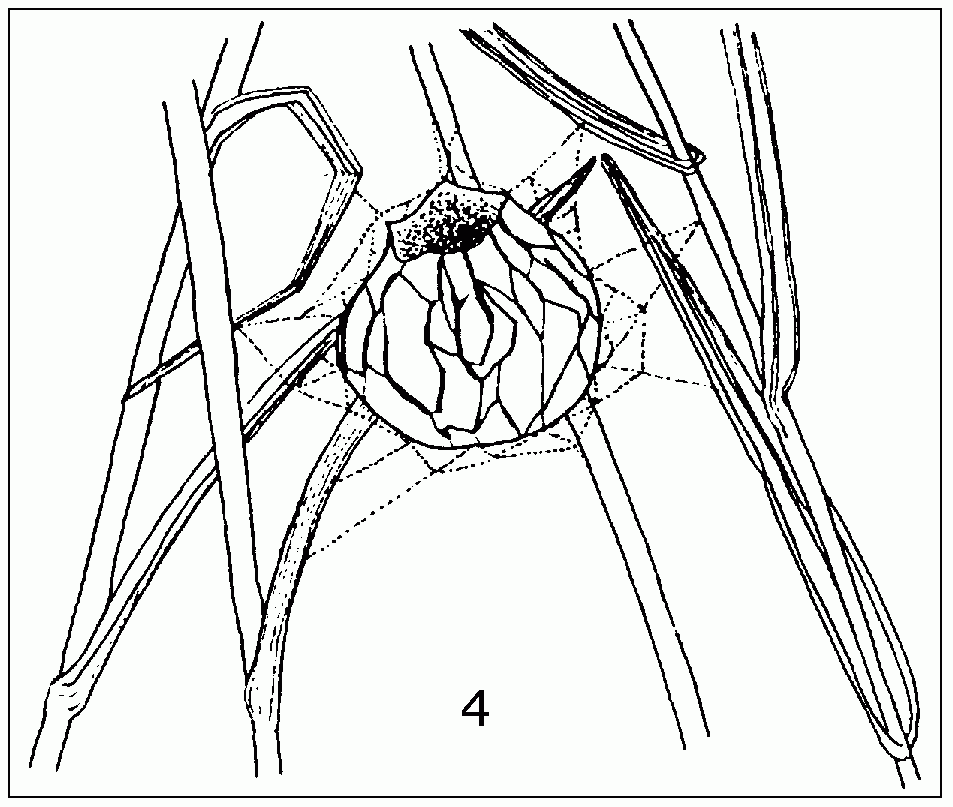
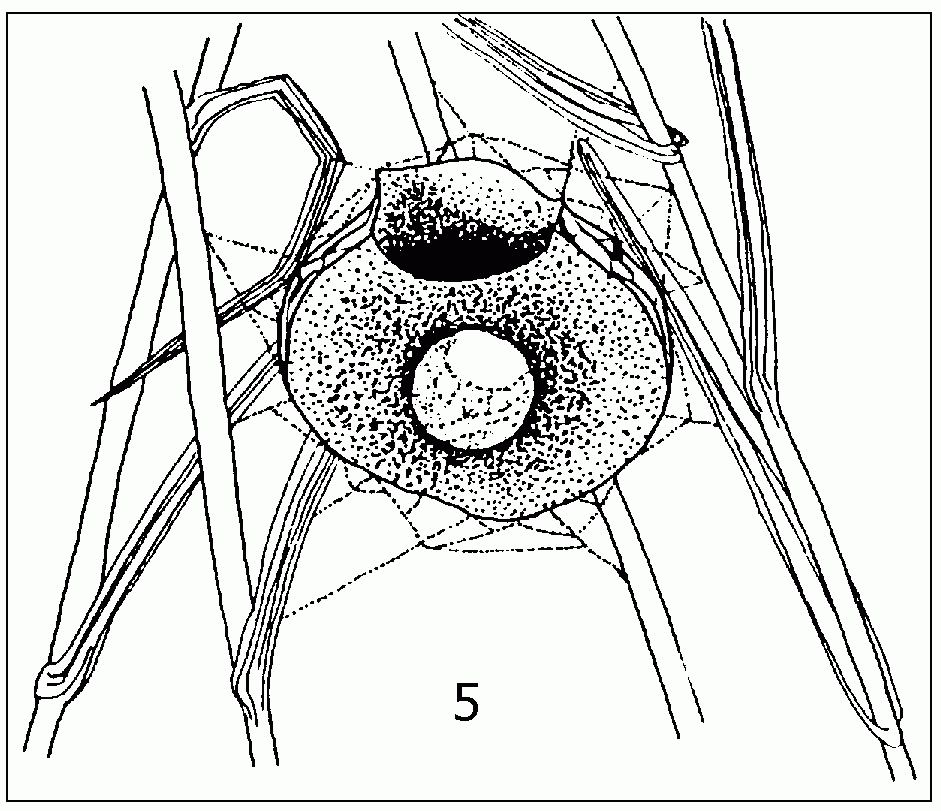

- Kokon mit zäher Hülle: Die Fäden des kugelförmigen Hüllgespinstes liegen so dicht beieinander, dass kein auch noch so feiner Wassertropfen eindringen kann. Eine solide Sturmverspannung sorgt ferner dafür, dass die zukünftige Kinderstube durch Wind, Regen und Schnee nicht losgerissen werden kann.
- Schnitt durch den Kokon: Zwischen Aussenhülle und Eiersack liegt eine Packung lockerer, in sich verschlungener, brauner Fadenwatte. Kein Schlafsack enthält eine derartig vollkommene Isolierschicht.
- Schnitt durch den Kokon und durch den Eiersack: Rund ein Monat nach dem Kokonbau schlüpfen die Jungspinnen, das Eiersackgespinst springt von selbst auf und entlässt die Brut in die krause, warme Fadenwatteschicht. Darin schlafen sie den ganzen Winter, bestens geschützt vor Kälte, Nässe und Wind. Nahrung benötigen sie keine, denn die Mutter hat jedem Ei einen genügend grossen Vorrat mitgegeben.
Insekten
Riesenholzwespe (Sirex gigas)



Lebensraum
Die Riesenholzwespen gehören zu den wenig bekannten Insekten. Gelegentlich finden wir die bis zu vier Zentimeter grossen, schwarz-gelben Tiere in Holzschlägen auf frisch gefällten, noch ungeschälten Nadelholzstämmen oder auf den Lagerplätzen von Sägereien. Die Holzarbeiter kennen sie als hornissenähnliche, schädliche Wespen.
Schlüpfakt
Mit viel Glück können wir die «Geburtsstunde» dieses Tieres beobachten: Mühsam und sorgfältig beisst sich die Riesenholzwespe mit ihren starken Mundwerkzeugen eine bleistiftdicke Röhre durch die äussersten Holzschichten und die darüberliegende Rinde frei. Leise knackende Geräusche verraten sie; bald streckt sie ihre Vorderbeine aus dem Loch und zieht den Körper mit deren Hilfe durch den engen Gang heraus. Behutsam putzt sich das bedrohlich aussehende Insekt die Fühler, seine wichtigsten Orientierungsorgane, und schon fliegt es weg.
Eiablage und Larvenentwicklung
Während der nächsten Tage und Wochen sind die Weibchen eifrig damit beschäftigt, ihre Eier ins Holz zu versenken. Dazu benützen sie einen Legestachel mit Sägezähnen, den sie ins noch saftige Holz treiben. Durch die fast haarfeine Legeröhre drücken sie ihre Eier hinunter, und zwar immer je eines pro Stichstelle. Im Stammesinnern schlüpfen die kleinen Holzwespenräupchen. Sie fressen sich langsam einen Gang durch die äusseren Holzschichten, wobei ihnen wahrscheinlich besondere Holzpilze die Nahrung «vorverdauen».
Ihre Entwicklungszeit bis zur Puppe dauert meist mehrere Jahre. Die hellgelben, fast weissen Raupen sind blind; sie brauchen ja im Dunkeln auch gar nichts zu sehen. Mit dem Hinterende drücken sie das Bohrmehl hinter sich fest. Nach fünf bis sechs Häutungen wären die Raupen verpuppungsreif, sie bleiben aber noch längere Zeit in ihrem letzten Larvenkleid liegen. Die Verpuppung und die Verwandlung zum Vollinsekt erfolgt wenige Wochen vor dem Schlüpfakt.
Schadwirkung
Riesenholzwespenlarven sind Schädlinge. Oft entwickeln sie sich auch im zu Balken und Brettern verarbeiteten Holz weiter, und die ins Freie drängenden, geschlüpften Wespen fressen sich dann sogar durch Mauerputz und Stoffballen hindurch. Die Bekämpfung ist recht schwierig. Am besten besorgen das die Riesenschlupfwespen.
Die Riesenholzwespe ist ein Holzschädling
Lebensraum
Wir finden die 4 cm langen, schwarz-gelben Insekten in Holzschlägen und Baumstamm-Lagerplätzen auf frisch gefällten, noch ungeschälten Weiss- und Rottannenstämmen, seltener auf solchen von Föhren, Lärchen, Eschen und Pappeln. Holzarbeiter kennen sie als hornissenähnliche, schädliche Wespen.
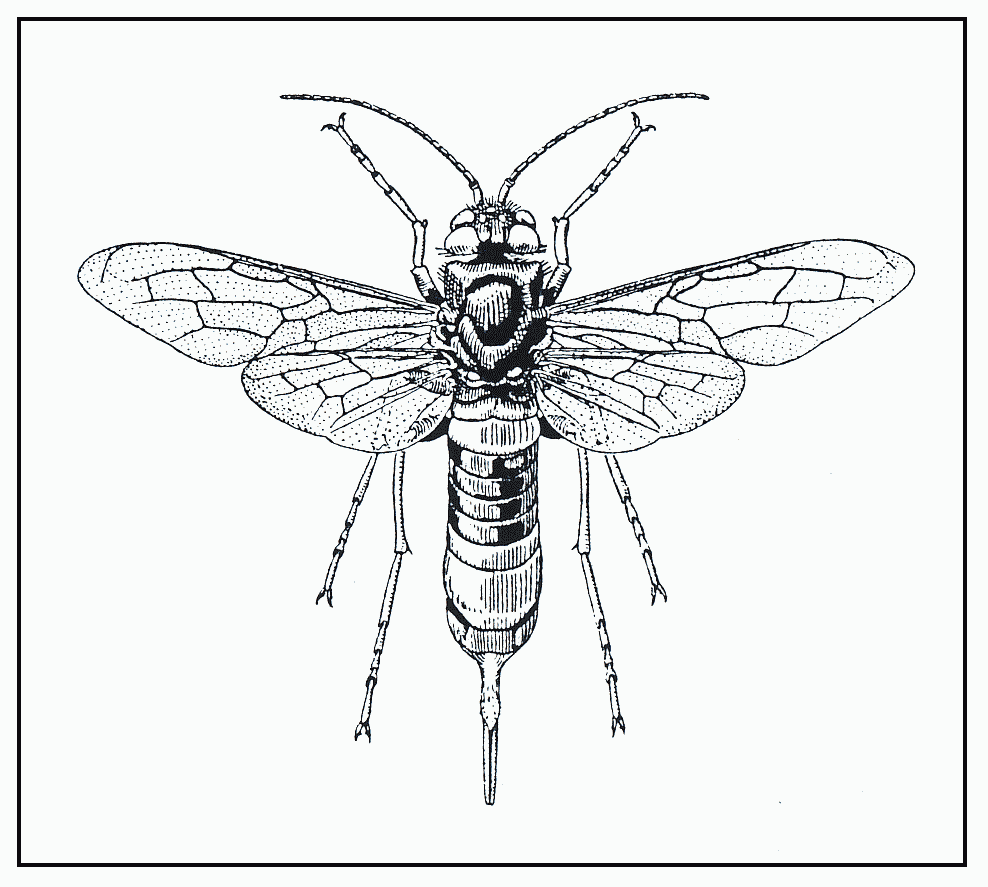
Schlüpfakt
Es ist ein schöner Zufall, wenn man zur richtigen Zeit genau an der Stelle eines am Boden liegenden Baumstammes steht, wo sich eine Holzwespe langsam durch die oberste Rindenschicht beisst. Sie verrät sich mit leisen knackenden Geräuschen. Auf einmal erscheint die Frontseite des Kopfes und langsam schiebt sich dann die Holzwespe ein Stück weit aus der blei-stiftdicken Röhre. Sobald das erste Beinpaar auf der Rindenoberfläche Halt findet, kann sie sich schnell befreien. Jetzt putzt sie ihre Fühler, und schon fliegt sie weg.
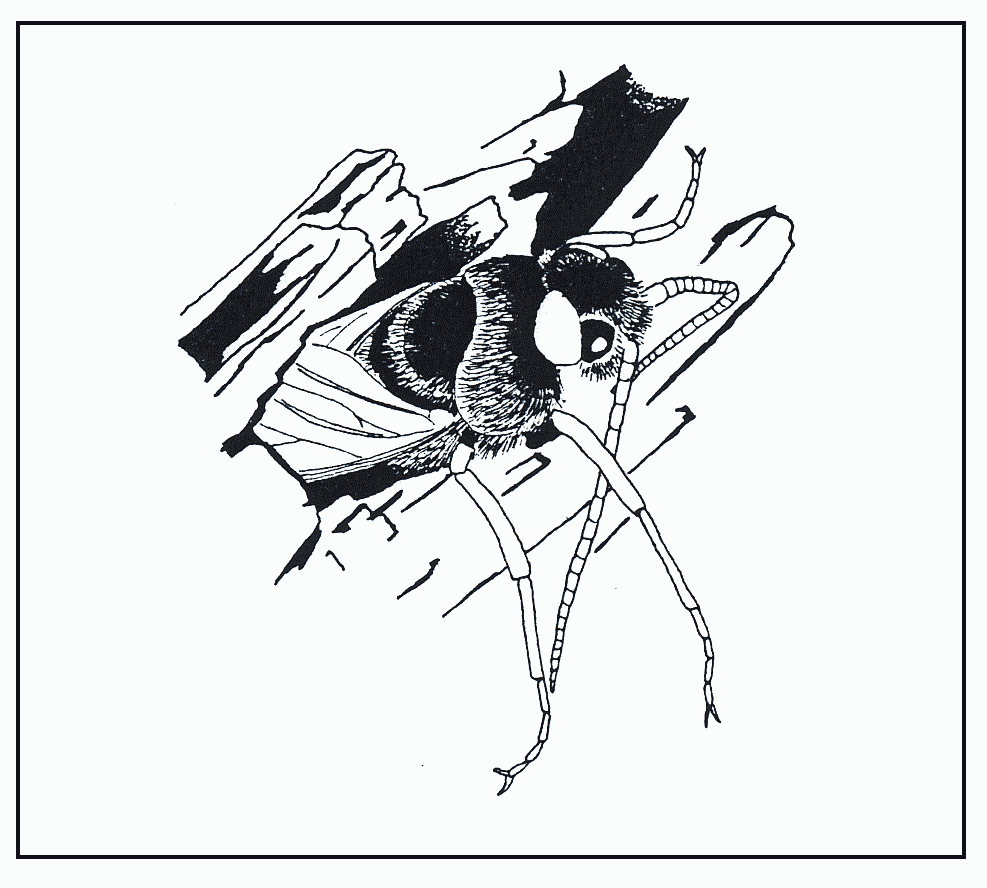
Eiablage und Bedeutung der Holzpilze
An sonnigen, warmen Tagen klettern die Weibchen auf ihnen zusagenden Baumstämmen herum, die vor geraumer Zeit geschlagen worden sind. An bestimmten Stellen stehen sie still, betrillern mit ihren Fühlern die Oberfläche und treiben dann den Legestachel langsam ins Holz hinein. Genau genommen sägen sie ein sehr dünnes, gut 1 cm tiefes Loch, in das sie ein Ei absetzen.
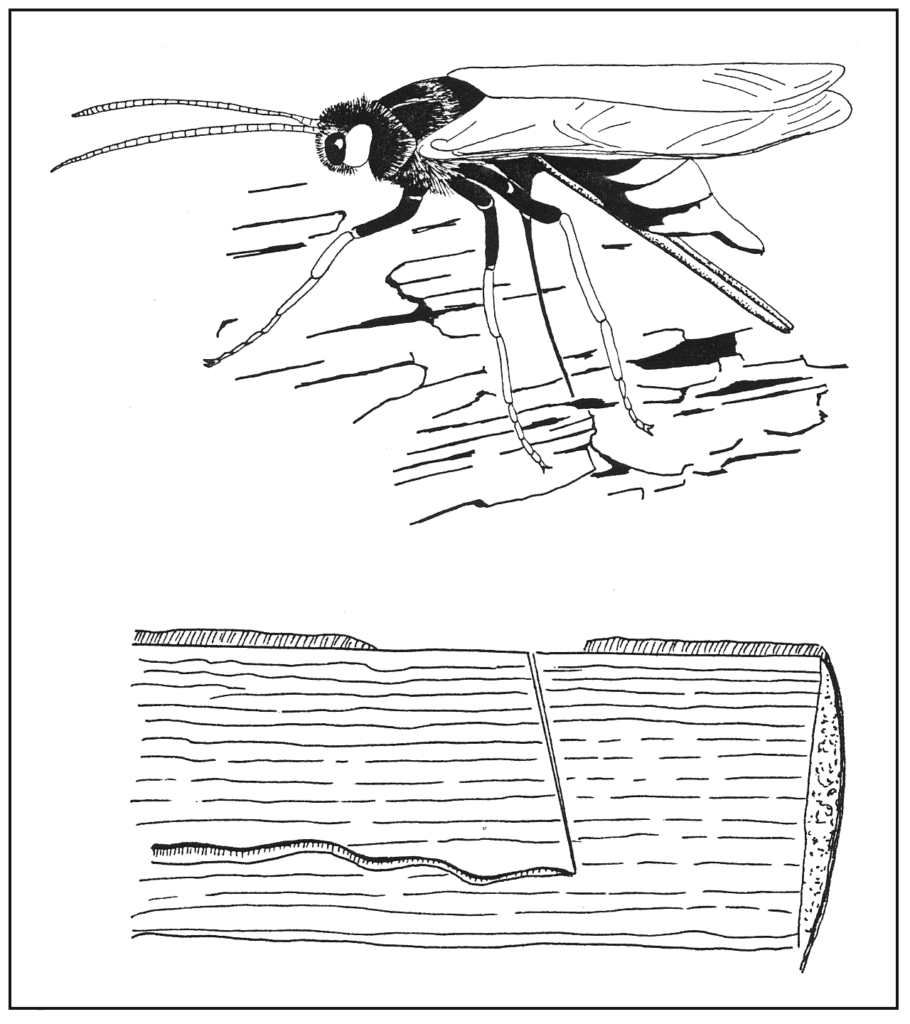
Aus dem Ei schlüpft bald eine Larve, die sich langsam einen Gang im äusseren Stammbereich frisst. Wahrscheinlich wird die Nahrung durch Holzpilze, die die Mutter bei der Eiablage mitgeliefert hat, vorverdaut.
Die Riesenholzwespe lebt nämlich in einem sehr engen Bündnis mit Pilzen. Man findet kurze Teile von Pilzfäden zunächst in speziellen Taschen im Leib der Schlupfwespenweibchen, wo sie in einer Schleimmasse eingebettet sind.
Diese Taschen münden in den Geschlechtsweg ein. Die Füllung der Taschen erfolgt in der Puppenwiege. Die Pilze dringen aktiv von den Wänden der Puppenwiege her in den Körper der Holzwespenpuppe ein und gelangen so in die Intersegmentaltaschen. Bei der Eiablage wird jedes Ei mit pilzhaltigem Schleim beschmiert. Auf diese Weise werden die Pilzsporen auf den Holznährboden gebracht und beginnen dort auszukeimen. Wahrscheinlich fressen dann die Holzwespenlarven die Pilzfäden auf.
Bau des Legebohrers von Holzwespen
Der Legeapparat besteht aus einer zweiteiligen Stachelscheide, in der ein dreiteiliger Bohrer liegt. Dieser setzt sich aus einer Stachelrinne und den beiden Stechborsten zusammen. Die Stechborsten besitzen je einen Falz, der in einer passenden Nut der Stachelrinne liegt. Die Stachelrinne ist also so etwas wie eine Führungsschiene für die beiden Stechborsten, die eigentlichen Bohrinstrumente.
Die untersten Abschnitte der Stechborsten gleichen verschiedenartigen Sägen, mit denen die Holzwespe feinste Holzteile aus dem Stichkanal raspelt. Die vordere Stechborste besitzt taschenartige Sägezähne, die zugleich als Schaufeln für das Herausschaffen des Bohrmehls dienen.
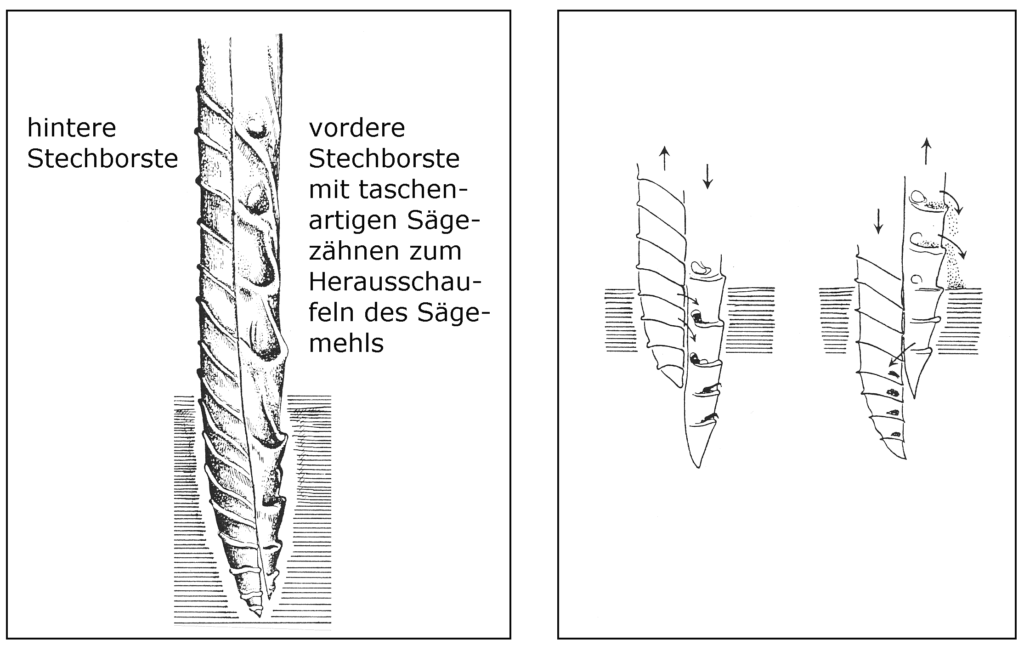
Links: Die beiden Stechborsten der Riesenholzwespe
Rechts: Abwechselndes Einstossen und Herausziehen der Stechborsten
Die Holzwespe stösst die Stechborsten abwechselnd vor, bis sie 6–10 mm weit ins Holz eingedrungen sind. Dann legt sie durch die auch als Legeröhre dienenden Stechborsten mehrere Eier in den Stichkanal. Die Teile des Stechapparates sind so gebaut und so angeordnet, dass sie auch als Eilegeapparat eingesetzt werden können.
Der ganze Vorgang – Einstechen, Eiablage und Herausziehen – dauert bis zu zwei Stunden. Ab und zu kommen auch Einstiche ohne Eiablage vor. Ein Weibchen lebt mehrere Wochen und legt insgesamt mehrere Hundert Eier.
Larvenentwicklung der Riesenholzwespe
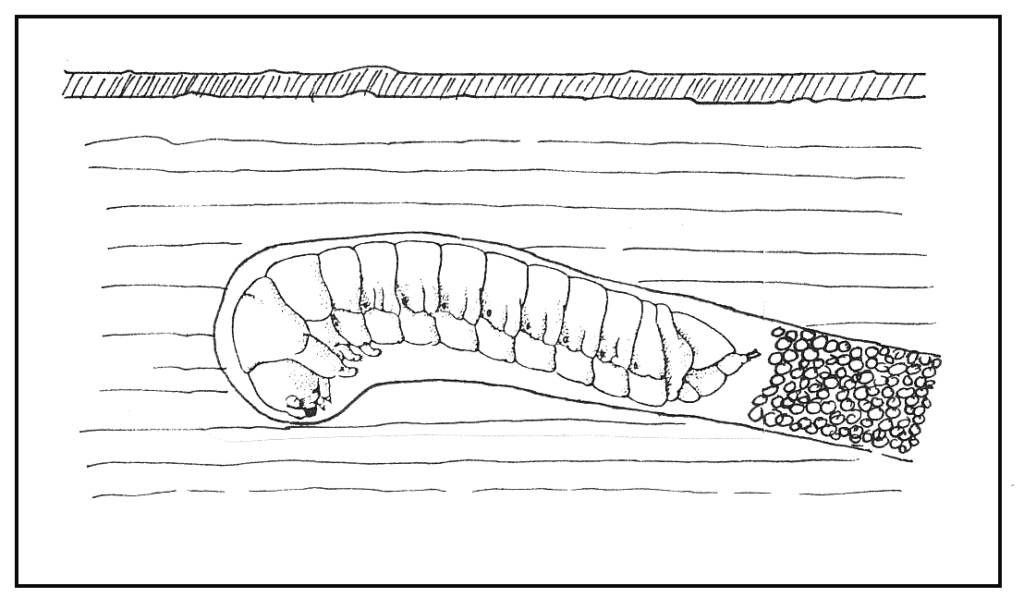
Ausgewachsene Larve
Die Holzwespenlarven fressen ihren Gang immer knapp unter der Oberfläche, damit sie nach der Verwandlung zum Vollinsekt keine dicke Holzschicht vor sich haben. Mit dem nicht verwertbaren Bohrmehl füllen sie den Frassgang wieder auf.
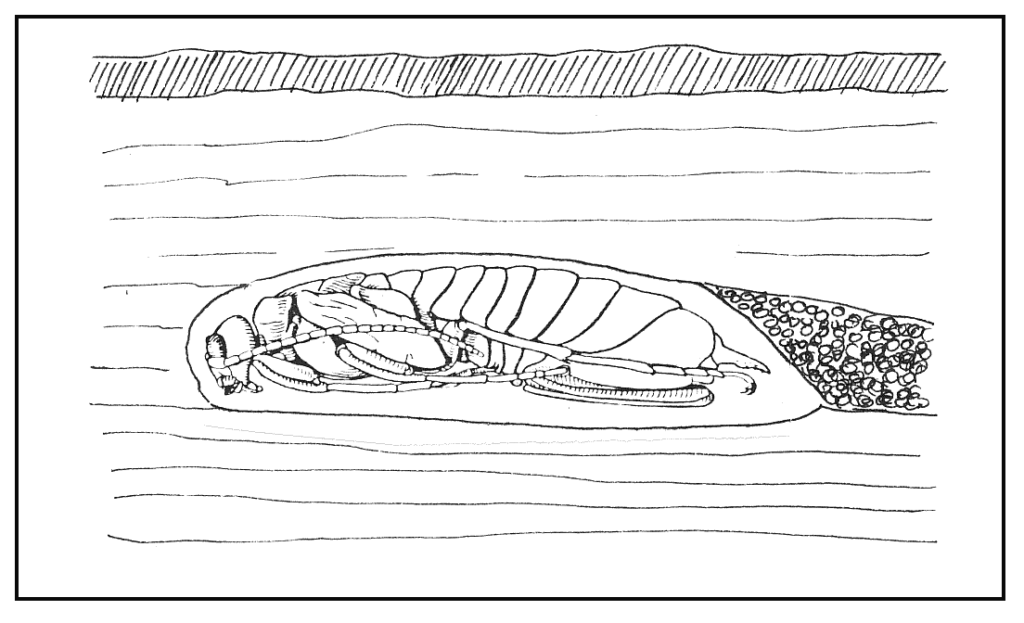
Puppe in abgeschlossener Puppenwiege
Meistens dauert die Larvenzeit mehrere Jahre. Nach 5–6 Häutungen wären die Raupen verpuppungsreif. Sie bleiben aber noch längere Zeit in ihrem letzten Larvenkleid liegen. Die Verpuppung und die Verwandlung zum Vollinsekt erfolgt wenige Wochen vor dem Schlüpfakt.
Schadwirkung der Riesenholzwespe
Gesundes Holz wird von den Holzwespen kaum je befallen. Sie suchen für die Eiablage im Absterben begriffene oder geschwächte und geschlagene Bäume.
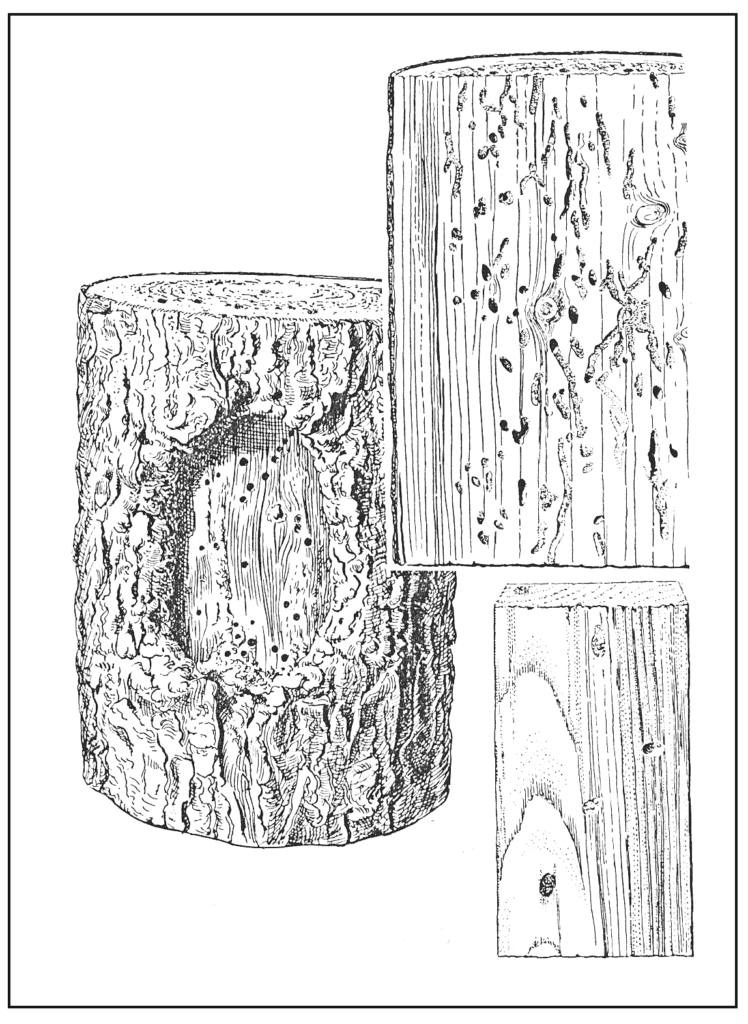
Nach Brauns 1964
Infolge der langen Entwicklungszeit der Holzwespen kommt es nicht selten vor, dass das Holz in der Zwischenzeit verbaut wird. Im allgemeinen wird die Tragfähigkeit von Balken durch die Bohrgänge von 4–7 mm Durchmesser und einer Länge von 28–35 cm pro Tier nur wenig vermindert, wenn sie ganz fest mit Bohrmehl zugestopft sind.
Bei ihrem Weg ins Freie können aber die frischgeschlüpften Holzwespen auch anderes Material zerstören. So bohren sie sich beispielsweise durch Linoleum oder Wandverputz hindurch. Erhebliche Verluste werden verursacht, wenn sich die Wespen durch ganze, auf Bretter aufgewickelte Stoffballen hindurch fressen.
Der Winterthurer Förster Gregor Fiechter beobachtete die Riesenholzwespe beim Bruderhaus im Eschenberg. Im Wolfshausdach frass eine Larve ein Loch durch ein Brett des Daches, durch das dann Wasser eindrang.
Die Bekämpfung ist recht schwierig. Am besten besorgt das die Riesenschlupfwespe.
Die Riesenschlupfwespe, der Erzfeind der Riesenholzwespe
Von den geheimnisvollen Fähigkeiten
Könnten wir Menschen derart fein riechen oder mit besonderen Organen leiseste Geräusche wahrnehmen wie unsere Riesenschlupfwespen, so ergäben sich für die Spionage Möglichkeiten, die alle bisherigen Methoden in den Schatten stellen würden. Verdeckte Fernsehkameras und Minispione aller Art wären schlagartig veraltet.
Die Riesenschlupfwespen brauchen für ihre Nachkommenschaft eine ganz bestimmte Nahrung, nämlich die in den Nadelholzstämmen lebenden Raupen der Riesenholzwespen. Die grosse Kunst besteht nun für die Schlupfwespen darin, ihre Opfer durch 2–4 cm dickes Holz aufzuspüren. Hätten wir Menschen die gleichen Möglichkeiten, so könnten wir bestimmte Gegenstände, wie etwa unsere Schuhe, durch mehrere Stockwerke hindurch riechen.
Neben Rhyssa persuasoria gibt es eine sehr ähnliche aber wesentlich grössere Art. Sie heisst Megarhyssa rixator und lebt in den gleichen Lebensräumen. Gelegentlich stechen beide Arten nebeneinander ins Holz.
Ortungsmethoden nahe verwandter Arten
Erstes Licht auf die rätselhaften Ortungsmethoden geben Beobachtungen an heiratslustigen Schlupfwespenmännchen nahe verwandter amerikanischer Arten. Wenn sich ein Weibchen im Innern des Holzes aus der Puppe und nachher durch die letzten Holzschichten nach aussen durcharbeitet, verursacht es Kaugeräusche und ein bestimmtes Knirschen. Ab Tonband tönt es nach Verstärkung etwa so, wie wenn wir Stücke von rohen Rüben abbeissen. Die Schlupfwespenmännchen sind in der Lage, diese Geräusche zu hören oder vielleicht besser zu ertasten. Ihre «Ohren» sitzen an allen sechs Füssen und bestehen aus vibrationsempfindlichen Sinneszellen. Wenn sich die Weibchen ans Tageslicht durchgearbeitet haben, werden sie vor der Paarung von den Männchen betrillert und berochen. Dazu benützen sie dann die sehr langen Fühler. So weit über die amerikanischen Verwandten.












Eiablage und Larvenentwicklung
Das Ortungsvermögen der Weibchen muss noch besser funktionieren und vor allem in der Lage sein, feinstens zu differenzieren. Das Leben der Nachkommen ist nur dann gesichert, wenn die Eier in die Larven der Riesenholzwespe gelegt werden. Würde das Ei irrtümlicherweise in ein anderes holzbewohnendes Insekt, etwa in eine Bockkäferlarve gelegt, kann der Schmarotzer entweder von den inneren Abwehrkräften des Wirts abgetötet werden, oder es kann auch das Umgekehrte geschehen: Der Wirt stirbt vorzeitig und damit auch der ungebetene Gast. Ein Irrtum der Mutter ist also für deren Larvenkinder tödlich.
Beobachten wir jetzt aber die eleganten, schwarz-gelben Riesenschlupfwespenweibchen, wenn sie erregt auf den Baumstämmen hin und herlaufen, dauernd mit ihren langen Fühlern das Holz betrillern und einmal da, einmal dort kurz anhalten, um besser «hinhören» zu können. Plötzlich bleibt eines stehen. Wir haben den Eindruck, als höre und rieche es etwas für uns im Holz Verborgenes. Sicher spielt auch der Tastsinn eine wichtige Rolle. Die Beine verändern zwei-, dreimal die Lage und die Fühlerenden werden aufs Holz gelegt und zurückgebogen. Schliesslich richtet sich der schlanke Hinterleib steil auf, und der fünf Zentimeter lange Legestachel wird sorgfältig auf die Holzrinde gesetzt. Mit den unerhört feinen Geruchs- und Tastsinneszellen in den Fühlern hat die Schlupfwespe eine Holzwespenlarve aufgespürt. Diese ist jetzt unrettbar verloren. Der Legebohrer erreicht sie nach wenigen Minuten. Ein haardünnes, gestieltes, im ganzen 12–13.5 mm messendes Ei leitet durch den feinen Stichkanal hinunter und bleibt auf der Haut des Opfers haften.
Einige Tage später schlüpft aus diesem Ei eine kleine, fusslose Made. Sie setzt sich auf dem «Wirt» fest und frisst ihn während der nächsten Wochen lebendigen Leibes auf. Die Holzwespenlarven, die ihr Leben für einen Nachkommen der Schlupfwespe hingeben müssen, sind grosse Holzschädlinge. Zugegeben, ihr Schicksal ist in schlupfwespenreichen Jahren hart. Sie sterben trotzdem kaum je aus, weil niemals alle aufgespürt werden. Es ist bekannt, dass gewisse im Holz rumorende Larven sich dann mucksmäuschenstill verhalten, wenn sie Geräusche der Schlupfwespen vernehmen. Die Treffsicherheit ihrer Feinde soll dadurch stark vermindert werden. Ob dieses Verhalten auch für die Riesenholzwespenlarven zutrifft, ist bis heute nicht erwiesen.
Literatur
- Brauns, A.: Taschenbuch der Waldinsekten, Fischer Verlag, Stuttgart 1964
- Jacobs, W.; Renner, M.: Taschenbuch zur Biologie der Insekten, Fischer Verlag, Stuttgart 1974
Waldwirtschaftliche Bedeutung
Die Riesenschlupfwespen messen mit dem Legestachel zusammen bis 8 cm. Sie sorgen dafür, dass sich die Riesenholzwespen nicht ins Uferlose vermehren können.
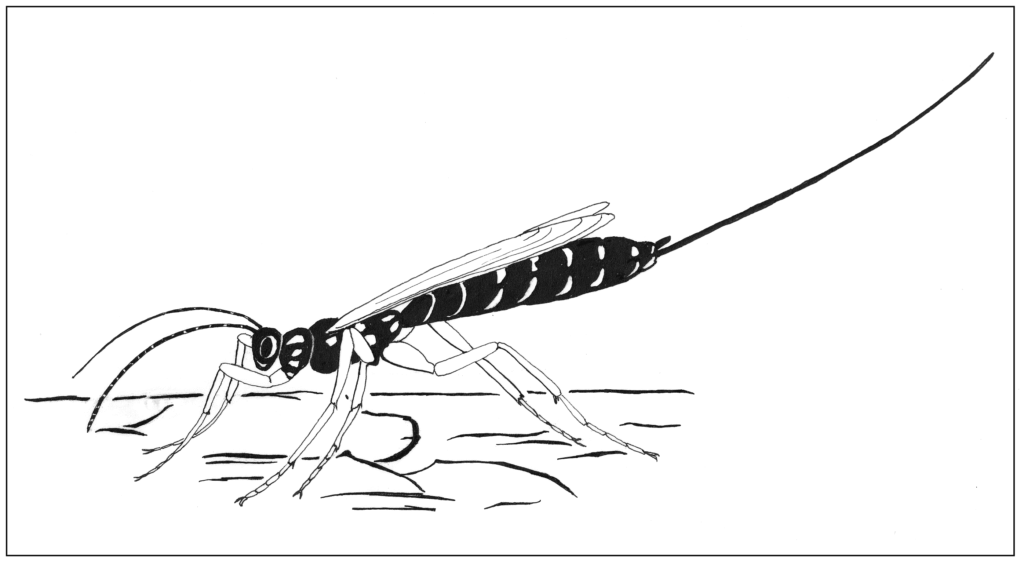
Die Fühler sind sehr wichtige Organe für die Ortung der Opfer. Der Legestachel liegt normalerweise in einem Etui, der so genannten Stachelscheide.
Legeapparat und Eiablage der Riesenschlupfwespe
Der Legeapparat setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Seine äusseren Teile bestehen aus zwei Stachelscheiden, die zum Schutz und zur Führung des inneren Teils, dem dreiteiligen Bohrer, dienen. Dieser besteht aus einer Stachelrinne und aus zwei Stechborsten. Die drei Teile sind so gebaut und so angeordnet, dass der Bohrer auch als Eilegeapparat eingesetzt werden kann. Durch das sehr dünne Rohr, sein Durchmesser beträgt weit weniger als 1 mm, gleiten die gestielten Eier.
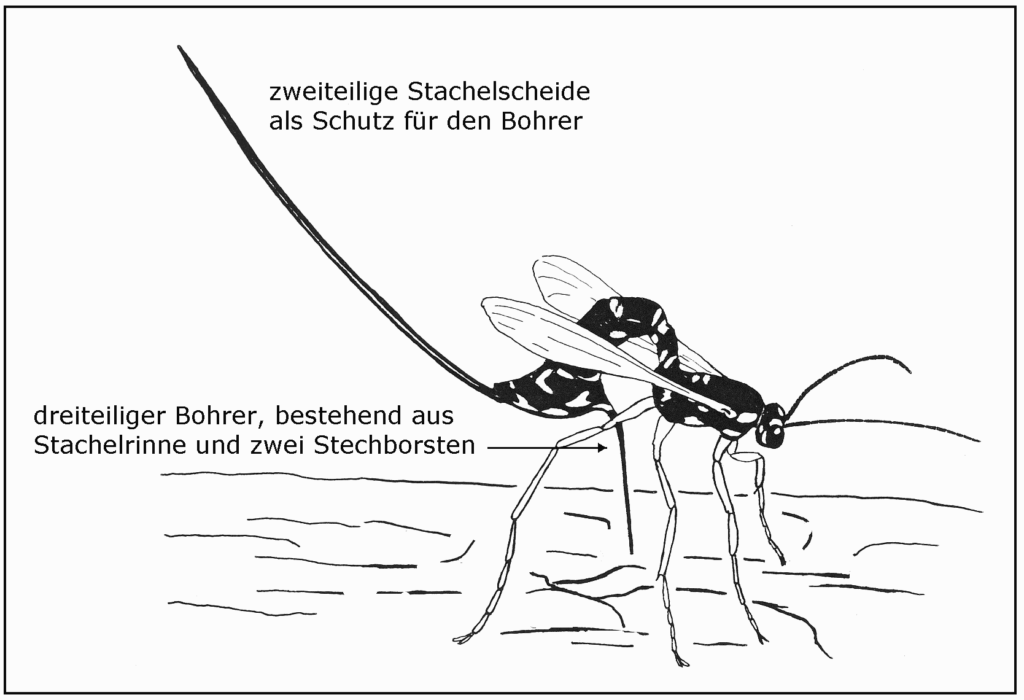
Das ganze Ei ist 12–13.5 mm lang, wobei der Stiel etwa viermal so lang ist wie das eigentliche Ei. Beim Durchtritt durch das Legerohr wird ein Teil des Eiinhaltes in den Stiel gepresst. So vermindert sich der Durchmesser des eigentlichen Eikörpers beträchtlich. Nach der Ablage auf dem Wirt, d.h. auf der Riesenholzwespenlarve Sirex gigas, fliesst der Inhalt wieder in das Ei zurück.
Ortung der Opfer durch die Riesenschlupfwespe
Für das Aufspüren der Wirte verfügen die Riesenschlupfwespen über hoch entwickelte Sinnesorgane. Mit lebhaft bewegten, mitunter pausenlos rhythmisch schlagenden Fühlern suchen die Weibchen nach Beutetieren. Wahrscheinlich können sie diese von verwandten Arten, die im selben Holz leben, unterscheiden. Sie müssen ferner erkennen können, ob das aufgefundene Tier bereits parasitiert worden ist, damit eine Doppelbelegung verhindert wird. Wie sie das machen, ist noch nicht bekannt.
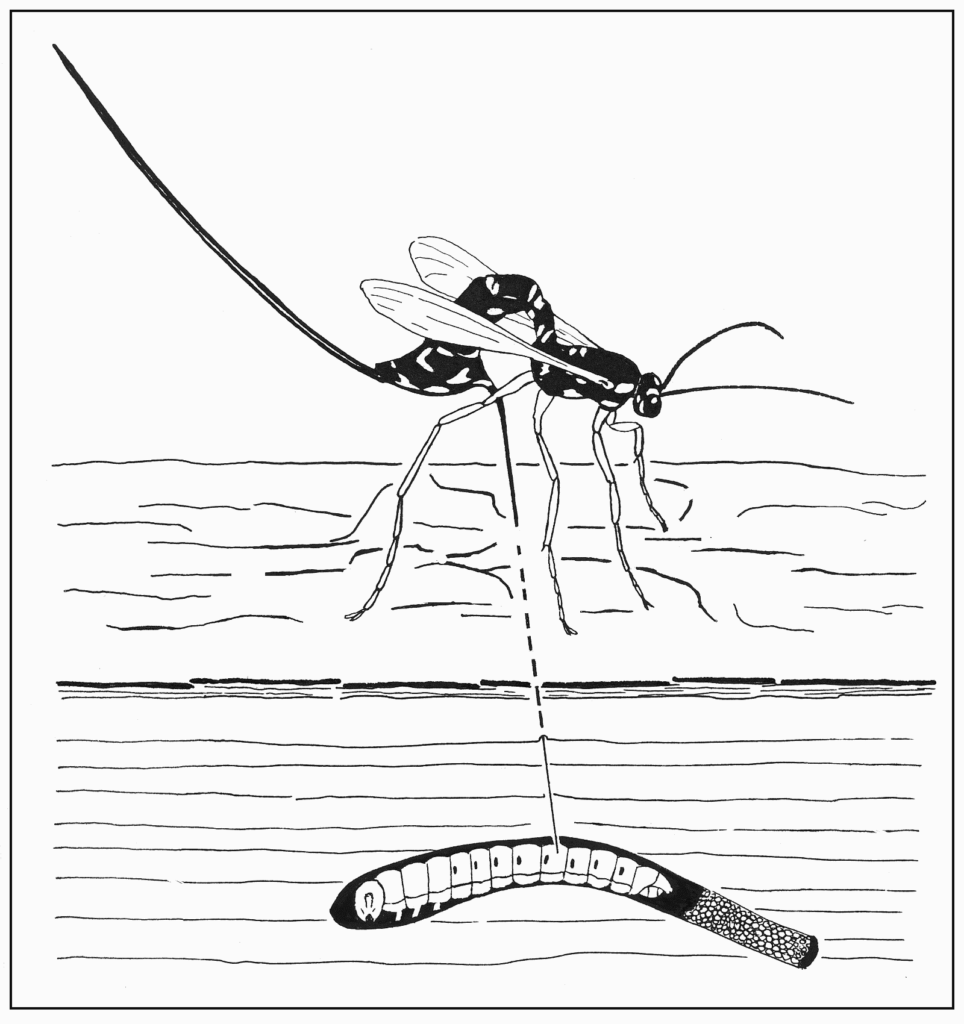
Die Schlupfwespen lassen sich in erster Linie vom Geruchssinn leiten. Dann kommen optische Reize in Frage, vor allem aber auch Tastreize, für deren Aufnahme die Sinnesorgane an Fühlern, Beinen und am Legeapparat dienen. Man vermutet ferner, dass durch die klopfenden Bewegungen der Fühler auf die Holzoberfläche Veränderungen der Resonanz wahrgenommen werden, wenn Frassgänge vorhanden sind. Ob die Schlupfwespen Einstichstellen der Holzwespen wahrnehmen können, ist zu bezweifeln, denn zwischen den Tätigkeiten der Holzwespen und der Schlupfwespen liegt mindestens ein Jahr.
Andere Holzinsekten



Verschiedene Wespen














Käfer
Goldglänzender Laufkäfer (Carabus auronitens)

Merkmale
Die Käfer werden 18–32 mm lang. Ihre Deckflügel und der Kopf sind goldrot, goldgrün oder selten blau glänzend, das am Ansatz schmale Halsschild ist rötlich, kupfern gefärbt. Die Färbung der Tiere ist sehr variabel. Die Deckflügel tragen jeweils drei kräftige, dunkle Längsrippen, zwischen diesen ist die Oberfläche gekörnt. Die Beine sind schwarz, nur die Schenkel sind rot gefärbt. Die Fühler sind schwarz, nur das erste Glied ist rot.
Vorkommen
Sie leben in feuchten und kühlen Laub- und Mischwäldern, in hohen Lagen auch auf unbewaldeten Gebieten. Man findet sie unter loser Rinde, in Totholz und im Moos. Sie kommen zwischen Mai und September vor.
Lebensweise
Die hauptsächlich nachtaktiven Imagines ernähren sich räuberisch von kleinen Tieren, wie z.B. Schnecken, Würmern und Insekten. Sie klettern dabei auf Bäume bis in etwa sechs Metern Höhe. Die Larven verpuppen sich nach dreimaligem Häuten. Ab dem Spätsommer bzw. Anfang Herbst schlüpft aus den Puppen die nächste Generation von Käfern. Diese Tiere überwintern unter Rinde oder zwischen Totholzritzen bzw. in Baumstümpfen und sind bereits früh im nächsten Jahr aktiv.
Schluchtwald-Laufkäfer (Carabus irregularis)

Merkmale
Der Schluchtwald-Laufkäfer erreicht eine Körperlänge von 19–30 mm. In der Grundfarbe ist der Käfer kupferrot bis rötlich glänzend gefärbt, die Flügeldecken und der Halsschild sowie die Flügelränder können in der Färbung von grün bis rotviolett variieren. Der Halsschild ist breiter als lang. Die unregelmässig angeordneten Punktgruben der Flügeldecken sind rotgolden oder grün gefärbt. Die Flügeldecken liegen sehr flach auf dem Körper auf, der Kopf ist im Verhältnis zum Halsschild relativ gross und besitzt grosse, asymmetrische Mandibeln. Die ersten beiden Glieder der Fühler sind rötlich gefärbt. Man findet sie von Juni bis September.
Lebensweise
Der Schluchtwald-Laufkäfer ist an feuchte und unterwuchsreiche Buchenwälder mit kalkreichem Boden gebunden, insbesondere an die Wälder der Nordhänge. Dort findet man ihn in Totholz oder unter lockerer Rinde.
Wie die meisten Laufkäfer ist der Schluchtwald-Laufkäfer ein nachtaktiver Räuber, der sich vor allem von Schnecken sowie von anderen Insekten und deren Larven ernährt. Auch die Larven leben räuberisch und entwickeln sich an Totholz. Die neue Generation schlüpft im Herbst. Die Überwinterung findet häufig in Gesellschaften statt.
nach Wikipedia, abgeändert
Sandlaufkäfer
Merkmale
Charakteristisch für die Sandlaufkäfer sind die typischen, mit hellen Zackenbinden oder Punkten gezeichneten, glänzenden, grün oder braun metallisch gefärbten Flügeldecken. Es sind kleine bis mittelgrosse Insekten (7–40 mm), die leicht an ihren langen, sichelförmigen und spitz bezahnten Mandibeln, den dünnen Laufbeinen, den kugelförmig hervorstehenden Augen und den 11-gliedrigen Antennen zu erkennen sind.
Lebensweise
Die Sandlaufkäfer ernähren sich räuberisch von kleinen Insekten und Spinnen. Ihre Larven lauern in senkrechten Erdröhren auf ihre Beute. Wenn sich die Käfer bedroht fühlen, können sie davonfliegen.
Verbreitung
Weltweit (ohne Tasmanien und Antarktis) mit etwa 2000 Arten verbreitet. In Nordamerika gibt es knapp 100 Arten. Für Europa wurden über 120 Arten nachgewiesen. Im südlichen Europa gibt es mehr Arten als im Norden.
Feld-Sandlaufkäfer (Cicindela campestris)

Aussehen
Die Käfer werden 10–15 mm lang und sind recht flach gebaut. Ihr Körper ist meist kräftig grün gefärbt, es gibt aber auch blaue und braune Exemplare. Fühler, Bauch und Hinterleib sind leuchtend kupferrot gefärbt. Die langen und schlanken Beine sind im Oberteil von gleicher Farbe, gegen die Tarsen zu werden sie jedoch grün. Auf den Deckflügeln befinden sich je ein gelblichweisser Fleck hinter der Mitte, sowie am Rand drei bis fünf weitere Makel gleicher Farbe. Die Färbung und Zeichnung variiert bei den verschiedenen Unterarten. Das Halsschild ist schmäler als der Kopf mit seinen grossen, gewölbten Facettenaugen, den zierlichen Fühlern, der mächtigen weissen bis hellbraunen Oberlippe und den darunterliegenden grossen Oberkiefern mit den nadelspitzen Zähnen. Die Deckflügel mit gut ausgebildeten Schultern sind breiter als der Kopf, verlaufen nahezu parallel und enden zusammen in einer flachen Rundung.
Vorkommen
Die Art ist in der Paläarktis, nördlich bis nach Lappland weit verbreitet. Sie bewohnt sonnige, trockene Gegenden, vor allem mit Sand- und Lehmböden vom Flachland bis ins Gebirge. Man findet sie von April bis September.
Lebensweise
Die gut entwickelten, grossen Augen und die langen, schlanken Beine weisen die Tiere als Jäger aus. Sie können kurze Strecken erstaunlich flink laufen, verharren dann aber wieder. Nähert man sich ungestüm, fliegen sie auf. Sie fliegen aber höchstens einige Meter und setzen sich dann so, dass sie dem Verfolger zugewandt sind. Dieses Spiel wiederholt sich mehrmals, bis der Käfer die Fluchtrichtung ändert und in einem Bogen zurückfliegt, oder sich im Gras verkriecht. Bei bewusstem Verfolgen zeigt sich, dass die Kraft deutlich nachlässt, wenn sich der Käfer mehrmals durch Fliegen der Verfolgung zu entziehen versucht.
Mit den Augen sieht der Käfer im Nahbereich sehr gut, so dass er auch flüchtige Beute überraschen kann. Er ernährt sich von Spinnentieren und kleinen Insekten, deren Aussenskelett er mit seinen spitzen Zähnen ohne Mühe durchdringt und sie anschliessend aussaugt. Er bevorzugt für seine Jagd offene Flächen mit keinem oder spärlichem Pflanzenbewuchs, z. B. sandige oder tonige Wege, auf denen Starten und Landen keine Schwierigkeiten bereiten, oder abgebrochene, der Sonne ausgesetzte Böschungen. An solchen Habitaten finden sich die Käfer meist in grösserer Anzahl. An diesen Stellen legen sie auch ihre Eier ab.
Die Larven leben in selbstgegrabenen Erdlöchern, wenige cm im Durchmesser und bis zu 40 cm tief, im gleichen Habitat. Sie ernähren sich wie die ausgewachsenen Tiere räuberisch. Bei Gefahr bringen sie sich durch Rückzug nach unten in Sicherheit, sonst sitzen sie direkt an der Öffnung, die sie mit Halsschild und Kopf verschliessen. Dabei ragen die grossen spitzen Zangen nach aussen. Nähert sich eine Beute auf etwa 4 cm Entfernung, wird sie gepackt und anschliessend ausgesaugt. Nicht nur der Bau der Zangen und des Brustschilds ist auf ihre Lebensweise abgestimmt, auch die Beine mit den Krallen und ein Höcker mit einem nach vorn gerichteten hornigen Häkchen am fünften Dorsalsegment ermöglicht ihr eine gute Beweglichkeit. Ein oder sogar mehrmals überwintert die Larve, bis sie sich am Grund ihrer Höhle verpuppt. Die Käfer schlüpfen im Herbst. Da die Lebensräume des Feld-Sandlaufkäfers zurückgehen, wird die Art immer seltener.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Berg-Sandlaufkäfer (Cicindela sylvicola)

Merkmale
Die Käfer werden mit 12–17 mm Länge etwas grösser als die Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida), sind ihnen aber zum Verwechseln ähnlich. Sie unterscheiden sich von ihnen durch Härchen, die C. sylvicola zwischen den Facettenaugen wachsen. Die Deckflügel sind grünlich-kupferfarben und haben weisse oder gelbe Zackenbinden (Flecken). Die ersten beiden Glieder der Labialpalpen sind gelblich, das Endglied ist dunkel. Das erste Fühlerglied besitzt zahlreiche Borsten.
Vorkommen
Der Berg-Sandlaufkäfer kommt vor allem in Mitteleuropa bis Mittelitalien und in Südosteuropa auf sonnigen, trockenen Waldwegen, auf lehmigen Böden, in Sand- und Kiesgruben und Steinbrüchen vor. Sie sind von April bis August zu finden.
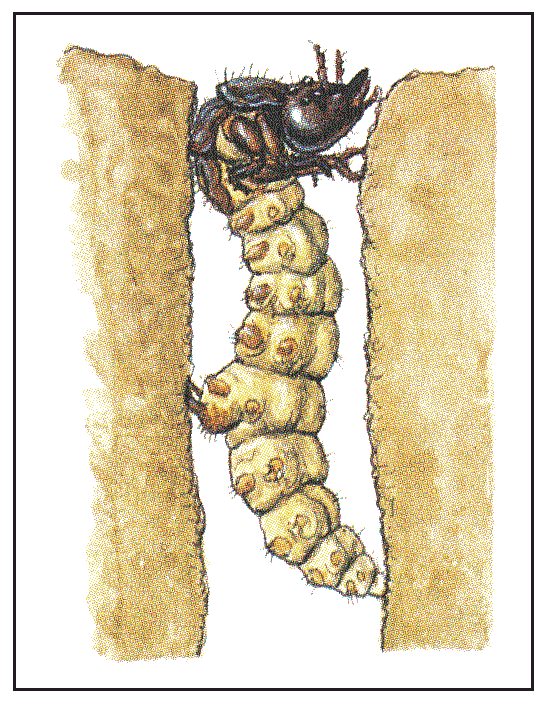
Lebensweise
Sowohl die Imagines als auch die Larven ernähren sich von Insekten. Die Paarung erfolgt im Juni, ab August schlüpft bereits die nächste Generation.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Gebänderter Pinselkäfer (Trichius fasciatus)

Aussehen
Der Gebänderte Pinselkäfer ist 9 bis 12 mm lang. Die schwarze Zeichnung auf den hellgelben bis tieforangenen Flügeldecken kann sehr variieren. Der restliche Körper ist mit gelben und weissen wolligen Haaren besetzt. Dadurch sieht er einer Hummel etwas ähnlich, was ihn besser vor Fressfeinden schützt.
Vorkommen
Auf Waldlichtungen ist der Käfer gebietsweise häufig. Er lebt zumeist auf Blüten auf Waldwiesen sowie Waldrändern.
Nahrung
Die Käfer ernähren sich von den Pollen diverser blütentragender Pflanzenwie Doldengewächsen, Rosen und Disteln. Auch Brombeersträucher werden regelmässig angeflogen. Die Larven ernähren sich überwiegend von Totholz und anderen organischen Pflanzenteilen.
Lebensweise
Die Larven entwickeln sich in vermoderndem Holz verschiedener Laubbäume. Der Käfer besucht im Juni und Juli vorwiegend Doldenblüten und ernährt sich dort von Pollen. Beliebt sind auch Rosen, Brombeerblüten und Thymian.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Lilienhähnchen (Lilioceris lilii)

Aussehen
Die Tiere werden 6–8 mm gross. Sie haben einen siegellackroten Halsschild, gleichfarbene Flügeldecken, einen schwarzen Kopf und schwarze Beine.
Vorkommen
Man findet das Lilienhähnchen in Wiesen, an Ufern, Gärten und Parkanlagen mit Liliengewächsen. Es ist der verbreitetste Lilien-Schädling in Europa.
Lebensweise
Larven und Imagines fressen an verschiedenen Lilienarten, aber auch an Maiglöckchen, Kaiserkrone oder Zwiebeln. Die Larven richten wegen ihres erhöhten Nahrungbedarfs dabei grösseren Schaden an als die Adulten. Sie tarnen sich, indem sie ihren Kot auf dem Rücken ablagern. Hierzu ist der After der Larven nach dorsal verschoben. Ihre gesamte Larvenzeit verbringen sie in diesem schleimigen Kothaufen, so dass nur der Kopf heraussieht. Auf diese Weise werden sie sogar von Vögeln verschmäht. Die Verpuppung findet nach Abstreifen der Kothülle in einem aus schaumigem, erhärtetem Sekret gebildeten Kokon in der Erde statt. Die Imagines lassen sich bei Gefahr schnell zu Boden fallen und bleiben zunächst reglos auf dem Rücken liegen, so dass ihre schwarze Unterseite unauffällig nach oben gerichtet ist. Bei Bedrohung können sie zudem ein zirpendes Geräusch erzeugen. Sowohl Männchen als auch Weibchen besitzen dafür quergeriefte Felder auf dem letzten Abdominalsegment, welche gegen die Flügeldeckenkante angestrichen werden. Lilienhähnchen überwintern als Puppe oder Imago und bringen ein bis drei Generationen im Jahr hervor.
Ernährung und Entwicklung
Weibchen legen insgesamt ca. 300 ihrer Eier in kleinen Gruppen auf der Blattunterseite ihrer Futterpflanzen ab. Die Eier sind etwa 1 mm gross, zylinderförmig und orangerot gefärbt. Nach zwei bis drei Wochen verpuppen sich die fertig entwickelten Larven im Boden. Nach weiteren ein bis zwei Wochen schlüpfen die Käfer. Es werden bis drei Generationen gebildet. Man findet sie von April bis Juni und im September auf den Frasspflanzen.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Gemeiner Bienenkäfer (Trichodes apiarius)
Der Gemeine Bienenkäfer ist ein Käfer aus der Familie der Buntkäfer. Alternative Trivialnamen sind Immenkäfer, Immenwolf oder Bienenwolf Letzterer ist aber auch die Artbezeichnung der Grabwespe Philanthus triangulum.

Merkmale
Die Käfer erreichen eine Länge von 8–15 mm. Die Flügeldecken sind abwechselnd orangerot und blauschwarz gebändert und das Flügeldeckenende ist dunkel. Kopf, Halsschild und Beine sind blau oder grün und glänzen metallisch. Die Vorder- und Mittelfüsse sind gelblich gefärbt, die Hinterfüsse dagegen braun. Die Fühler besitzen eine dreigliedrige Fühlerkeule, deren letztes Glied an der Seite spitz ausgezogen ist. Der Körper und die Beine sind lang behaart, der Kopf und der Halsschild sind mit braunen Härchen versehen. Der Halsschild ist fein punktiert.
Lebensweise
Die Larven leben räuberisch in den Nestern verschiedener Solitärbienen und in den Bienenstöcken der Europäischen Honigbiene. Die genauen Zusammenhänge der Larvalentwicklung sind bisher noch nicht zufriedenstellend geklärt.
Der ausgewachsene Käfer hält sich im Mai und Juni auf Doldenblütlern auf und jagt hier andere Blütenbesucher. Er frisst aber auch Blütenstaub. Er bevorzugt warme und sonnige Orte, wie z. B. Waldränder, Trockenwiesen und Gärten.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata)

Merkmale
Die Käfer werden 5.2–8 mm lang. Die roten Deckflügel haben jeweils drei schwarze Punkte. Ein siebter schwarzer Punkt, nach vorne von zwei weissen, dreieckigen Flecken flankiert, findet sich auf dem Schildchen. Die Männchen unterscheiden sich äusserlich kaum von den Weibchen.
Vorkommen
Die Käfer kommen in Europa, Asien, Nordafrika und auch in Nordamerika sehr weit verbreitet und häufig vor. Sie bewohnen sowohl offenes als auch bewaldetes Gelände, allerdings ist das Vorkommen von Blattläusen obligatorisch. Die Tiere sitzen meist auf Blättern in der Nähe von Blatt- oder Schildlaus-Kolonien, von denen sie sich ernähren. Man findet sie vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein.
Lebensweise
Die Käfer überwintern in Kolonien aus recht vielen Tieren am Boden zwischen Moos, Gras oder Laub. Oft kommen sie dafür aber auch in Gebäude, wo sie wegen der trockenen und warmen Luft aber meistens sterben. Nach der Paarung legen die Weibchen etwa 400 ca. 1.3 mm lange Eier auf Pflanzenteile, die von Blattläusen befallen sind. Dies sind vorzugsweise Blattunterseiten. Die bunt gezeichneten Larven haben eine ähnliche Lebensweise wie die Käfer. Sie ernähren sich von Blattläusen oder anderen Eiern des Geleges, die schon verlassen wurden. Insgesamt fressen sie während ihrer Entwicklung etwa 400 Blattläuse. Sie durchlaufen vier Entwicklungsstadien bis zur Geschlechtsreife. Die Dauer der Stadien hängt von der Aussentemperatur ab. Die Larven überwintern nicht, sondern verpuppen sich bereits nach einigen Wochen. Die Puppen hängen von Pflanzen herab und sind ebenfalls bunt gemustert. Die Entwicklungsdauer beträgt 30–60 Tage, so dass es normalerweise zu zwei Generationen pro Jahr kommt. Die Lebenserwartung der Tiere beträgt etwa 12 Monate.
Die Siebenpunkt-Marienkäfer werden als Nützlinge angesehen, weil sie grosse Mengen an Blattläusen vertilgen. Sie gehören zu den ersten Tieren, die in der biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt wurden.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Borkenkäfer
Die Borkenkäfer bilden eine Unterfamilie der Rüsselkäfer. In Europa gibt es etwa 154, weltweit 4000 bis 5000 Arten. Wir kennen sie in erster Linie wegen der starken Schäden, die einige Arten nach Massenvermehrungen in Wäldern anrichten können.

Biologie
Zur Eiablage bohren die Borkenkäfer Gänge in die Rinde oder in das Holz. Hierbei entstehen charakteristische Brutbilder oder Brutsysteme. Es gibt Rindenbrüter und Holzbrüter.
Die Larven der Rindenbrüter ernähren sich von den saftführenden Schichten des Baumes in der Rinde. Da diese Schicht die Lebensader des Baumes darstellt, führt der Befall meist zu dessen Absterben.
Wichtige Rindenbrüter und ihre bevorzugten Baumarten:
- Buchdrucker (Ips typographus): Fichte
- Kupferstecher (Pityogenes chalcographus ): Fichte
- Grosser und Kleiner Waldgärtner: Kiefer
- Eichensplintkäfer: Eiche
- Buchenborkenkäfer: Buche
Die Larven der Holzbrüter leben im Holzkörper und ernähren sich von Pilzrasen (Ambrosia), die das Muttertier anlegt:
- Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Trypodendron lineatum) an liegendem Nadelholz
Im Allgemeinen sind Bäume auf ihnen zusagenden Standorten gesund und in der Lage, sich wie Fichten durch Harz gegen Borkenkäfer zu wehren. Einzelne Borkenkäferarten bringen hingegen geschwächte Bäume zum Absterben und schaffen so Platz für Neubesiedelungsversuche von Bäumen, die dem Standort besser angepasst sein können. Neben den natürlichen Fichtenwäldern höherer Gebirgslagen hat der Mensch mit ausgedehnten reinen Fichtenbeständen optimale Borkenkäferbiotope geschaffen. Hier können sich bei klimatischen Extremen (lange Hitze- oder Trockenperioden, Winter mit viel Schneebruchholz) Buchdrucker und Kupferstecher explosionsartig vermehren (Jahre mit Massenvermehrung sind beispielsweise: 1994/95, 1999, 2003/2004). Die meisten Borkenkäferarten sind jedoch nicht in der Lage, lebende Bäume zum Absterben zu bringen.

Die Vermehrung wird insbesondere durch eine trockene und warme Witterung gefördert. Die Käfer vermehren sich über einen Schwärmflug. Innerhalb von 1–2 Wochen befallen sie vor allem Fichten. Zu diesem Zweck bohren sich die Käfer durch die Rinde der Bäume und legen dort ihre Eier ab. Durch ihren eigenen Frass und den der Larven wird das für den Baum lebensnotwendige Bastgewebe zerstört.
Lässt es die Witterung zu, fliegen die Altkäfer erneut aus, um sogenannte Geschwisterbruten, anzulegen. Die Schlüpfzeit beginnt im April.
Von der Eiablage bis zum fertigen Käfer dauert es 4–6 Wochen. Es kann im Laufe eines Jahres zu 2–3 Käfergenerationen und 2 Geschwisterbruten kommen. Ein Weibchen produziert in seinem Leben rund 5000 Nachkommen. Aus einem befallenen Stamm entfliegen sogar bis zu 20000 Käfer, wobei gerade einmal 200 Käfer ausreichen, um einen Baum zum Absterben zu bringen. Wegen ihrer besonderen Frosthärte überleben Käfer, Larven und Puppen auch harte Winter.
Buchdrucker (Ips typographus)
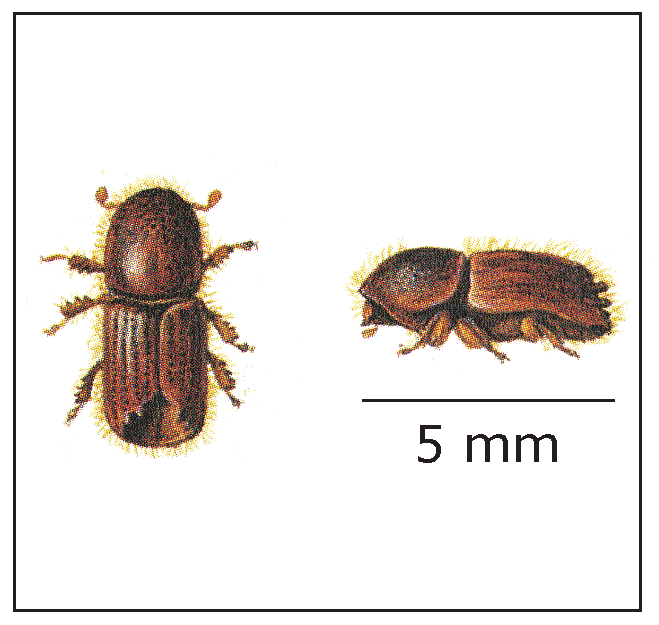
Die Larvengänge des Buchdruckers ähneln den Schriftzügen in einem aufgeschlagen Buch. Der Körper ist walzenförmig, dunkelbraun und hat einen gelblichen bis braunen Haarbesatz. Die Anatomie und Physiologie gleicht weitgehend anderen Käfern. Sie sind 4,5 – 5,5 mm lang. Der Kopf besitzt einen nur schwach ausgebildeten Rüssel. Die Brust zeigt einen kräftig entwickelten Halsschild. Dieser und die Flügeldecken bestehen vorwiegend aus Chitin und bedecken das gesamte Abdomen.

Bei trockener Witterung kann eine Massenvermehrung der Käfer stattfinden, der dann ganze Nadelholzbestände zum Opfer fallen können. Kränkelnde Bäume strömen einen besondern Duft aus, der die Borkenkäfer anlockt. Der Buchdrucker schwärmt im Frühling ab Mitte bis Ende April aus. Das geschieht bei Temperaturen ab 16,5°. Der Befall der Bäume lässt sich schon frühzeitig am Auswurf brauen Bohrmehls erkennen, das sich u.a. in Rindenschuppen und auf der Bodenvegetation sammelt.

Die männlichen Käfer legen Rammelkammern an, in die sie die weiblichen Tiere locken und begatten. Die Weibchen bohren dann Muttergänge, in dessen Seitenwände sie Nischen bauen, in die sie dann jeweils ein Ei legen. Jeder Gang ist bis zu 30 cm lang und enthält 20 bis 80 Eier. Diese Gänge werden von der Käfermutter mit Bohrmehl verschlossen.
nach Wikipedia, abgeändert und erweitert
Weitere Käfer



















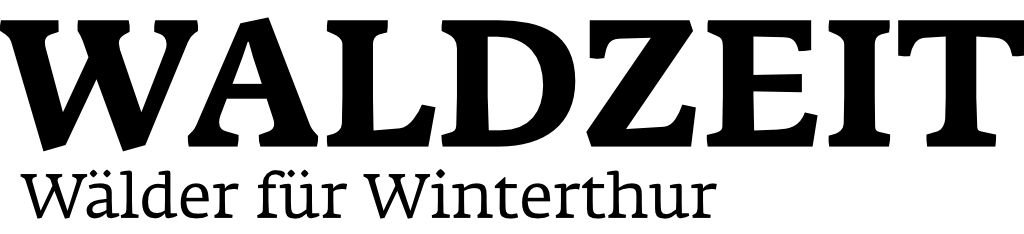
Schreibe einen Kommentar